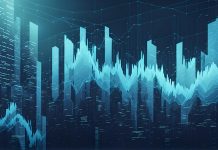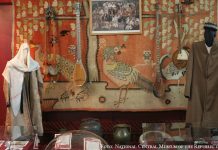Am 27. und 28. September feiert das erste Zentralasiatische Kurzfilmfestival in Berlin seine Premiere. Es ist eine eher kleine, sehr persönliche Initiative, die sich aus intensiven Begegnungen und einer großen Leidenschaft von Amina Alish und Danyil Potopaiev entwickelt hat – ursprünglich als eine Vision, die vielfältigen Facetten der zentralasiatischen Kulturen jenseits der gängigen Klischees sichtbar zu machen.
Ohne ein großes Budget, aber mit enormem Engagement und beeindruckendem Teamgeist ist es ihnen gelungen, daraus ein tragfähiges, kulturelles Projekt zu gestalten. In diesem Artikel nehme ich Sie mit hinter die Kulissen dieser lebendigen Initiative, erzähle von den Herausforderungen und Erfolgen bei der Festivalgründung und zeige, wie Kultur zu einem bedeutsamen Werkzeug werden kann, um Integration zu beleben und neue gesellschaftliche Verbindungen zu knüpfen.
Klischees über Zentralasien überwinden
„Das war eine kleine Initiative, die aber dennoch, obwohl sie genau so geblieben ist, viele interessierte Menschen um sich versammelt hat“, erzählt Amina.
Sie stammt aus Usbekistan und ihre Erfahrungen mit mehreren europäischen Filmfestivals, die zentralasiatische Filme beinhalteten, waren von ernüchternden Botschaften geprägt:
„Es wurden oft Filme gezeigt, die den Eindruck hinterließen, die ganze Region wäre verloren, alles sei traurig und trist. Das hat mich sehr berührt und traurig gemacht.“
Ihr Antrieb war es, andere Geschichten zu erzählen – Geschichten mit „mehr Vielfalt, mehr Hoffnung“ –, um diese Stigmatisierung zu überwinden, die zentralasiatischen Filmen oft anhängt.
Mit dem Wunsch, zentralasiatisches Kino auch auf dem Campus der Freien Universität Berlin zu zeigen, wandte sie sich an ihre Professorin und schlug vor, eine Retrospektive zu organisieren, die moderne Werke mit sowjetischen Archivfilmen verbindet. Diese Idee war der Zündfunke zu mehr: Durch ein Netzwerk persönlicher Kontakte kam sie mit Danyil in Verbindung, der wertvolle Erfahrungen in der Organisation von Kurzfilmprogrammen mitbrachte.
„Ich war beim ukrainischen Filmfestival in Berlin aktiv, habe mich viel mit Kurzfilmfestivals beschäftigt und konnte dadurch mein Wissen einbringen“, berichtet Danyil. Ursprünglich kommt er aus der Ukraine und war von Aminas Idee, die ihm eine neue, spezifische Perspektive auf Zentralasien eröffnete, tief beeindruckt.
Die Entscheidung, den Fokus komplett auf Kurzfilme zu legen, war bewusst:
„Langfilme brauchen viel mehr Zeit und Geld, besonders wegen der Rechteklärung. Kurzfilme sind viel zugänglicher, dynamischer und passen besser zum heutigen Zeitgefühl“, erklärt Danyil.
So konnten sie finanzielle und praktische Herausforderungen geschickt meistern und sich auf die inhaltliche Vielfalt konzentrieren.
Neue Kontakte knüpfen
Eine bedeutende Rolle hat das Networking gespielt, Amina und Danyil konnten viele neue Kontakte knüpfen – insbesondere zur Tashkent Film School. Dort fanden sie wichtige Partner, darunter Valeriya Kim, die Programmleiterin des Cinema-Love Filmfestivals in Usbekistan, sowie Gulnoza Irgasheva, Mitbegründerin des feministischen Kollektivs Maqaal aus Usbekistan. Gemeinsam gestalteten sie eine breit gefächerte, lebendige Programmauswahl, die nun beim Festival in Berlin Premiere feiert.
Über die Online-Plattform und Social Media erreichte das Festival bereits im Vorfeld große Aufmerksamkeit: Rund 1.200 Einreichungen kamen, wovon etwa 300 thematisch passend waren. Aus diesen wählten die Organisatoren vier thematische Blöcke: Erinnerungskultur, Generationendialoge, regionale Identitäten und das Empowerment junger Menschen.
Zahlreiche junge Regisseurinnen und Regisseure aus Zentralasien wurden ausgewählt, was die lebendige Kreativität und Vitalität der Region beweist.
Details sind wichtig: Das Symbol des Festivals
Das Logo des Festivals zeigt die Silhouette eines neugierigen Schafs, das direkt in die Kamera blickt – ein Symboltier, das tief in der Kultur Zentralasiens verwurzelt ist. Doch hier ist es nicht nur ein schlichtes Herdentier:
„Unsere Schaf steht für Selbstständigkeit, Neugier und die Fähigkeit, sich über das Bekannte hinauszuwagen“, erläutert Danyil.
Es steht symbolisch für die Szene, die sich als eigenständig und selbstbewusst präsentiert, auch wenn sie oft in Gruppenzusammenhängen dargestellt wird.
Diese symbolische Darstellung spiegelt auch den Anspruch des Festivals wider, das sich selbst an der künstlerischen Avantgarde sieht. Zentralasiatisches Kino hat auf der Berlinale bereits beeindruckt – und nun bringt das Kurzfilmfestival eine ganz neue Bühne nach Berlin, um weitere Stimmen und Perspektiven sichtbar zu machen.
„Wir möchten, dass das Festival nicht nur die Diaspora anspricht, sondern auch ein breites Berliner Publikum erreicht“, betont Amina.
Deshalb fiel die Auswahl der Spielstätte auf das Kino „Sinema Transtopia“, das sich auf nicht-europäisches Kino spezialisiert hat und ein atmosphärisch offenes, interessiertes Publikum bietet. Parallel wird das Festival auch in der Kinoxona der Tashkent Film School gezeigt, wo ebenfalls reger Austausch stattfindet.
Das Festival präsentiert Filme aus Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan sowie aus dem Ausland, etwa aus Belgien und Deutschland, aber stets mit direktem Bezug zur Zentralasien-Region. Das Programm steht schon fest und kann online eingesehen werden – ein umfangreiches Panorama kultureller und gesellschaftlicher Themen.
Von düsteren Realitäten zu hoffnungsvollen Perspektiven
Die Auswahl der Filme ist bewusst breit gefächert und zeigt „nicht nur die harten Schattenseiten, sondern auch viele Gründe, warum es sich lohnt, in dieser Region zu leben“, erklärt Amina. Die Filmauswahl spiegelt komplexe Lebenswirklichkeiten wider und bietet sowohl Dokumentationen als auch fiktionale Werke mit vielfältigen Erzählweisen.
Die Werbeaktivitäten für das Festival wurden unter anderem von zahlreichen Zeitschriften und Medienagenturen aus Zentralasien unterstützt. Diese Kooperationen stärken die Vernetzung zwischen Berliner Organisatoren und Filmemacher:innen aus der Region und darüber hinaus.
Das Team hinter dem Festival
„Es war wirklich ein glücklicher Zufall, dass wir uns gefunden haben“, reflektieren Amina und Danyil über ihre Zusammenarbeit. Beide sind Studierende am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin und sehen das Festival als eine partizipative kulturelle Brücke, die Integration mit Leben füllt und gleichzeitig andere Facetten Zentralasiens ins öffentliche Bewusstsein bringt.
Für die Zukunft planen sie, das Festival in anderen europäischen Metropolen wie London, Paris und Warschau zu präsentieren. „Der Weg wird sicherlich nicht einfach, aber mit Leidenschaft, Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung ist vieles möglich“, sagt Danyil.
Diese junge Generation von Kulturschaffenden zeigt mit dem Zentralasiatischen Kurzfilmfestival in Berlin eindrucksvoll, wie kreative Initiativen neue Verbindungen schaffen und multikulturelle Vielfalt erlebbar machen können. Es ist eine Einladung an alle, das Festival zu besuchen und selbst Teil dieser lebendigen Kulturbrücke zu werden.