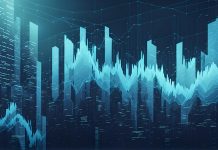Am 8. August 2025 fiel in der Nähe des Dorfes Ulken am Ufer des Balchaschsees der symbolische Startschuss für den Bau des ersten kasachischen Kernkraftwerks. Vertreter des kasachischen Atomwirtschaftsfonds und der russischen Atombehörde Rosatom setzten dabei eine sogenannte „Atomkapsel“ – ein feierlicher Akt, der den Beginn der technischen Arbeiten markiert. Noch handelt es sich vor allem um vorbereitende Maßnahmen: Bohrungen, Bodenanalysen sowie seismische und hydrogeologische Untersuchungen sollen die Eignung des Geländes klären.
Die geplante Anlage wird mit Kosten von rund 15 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Sie soll mit zwei VVER-1200-Reaktoren der Generation 3+ ausgestattet werden, die zu den modernsten Druckwasserreaktortypen zählen. Der Bau basiert auf einem landesweiten Referendum im Oktober 2024, bei dem rund 71 Prozent der teilnehmenden Bevölkerung für die Nutzung der Kernenergie gestimmt hatten. Im Juni 2025 entschied sich Kasachstan nach einem internationalen Auswahlverfahren für Rosatom als Hauptauftragnehmer. Parallel dazu wird China mit dem staatlichen Unternehmen CNNC ein zweites Kernkraftwerk im Land errichten.
Atomares Cluster bis 2050
Ein zentrales Ziel Kasachstans ist es, den Betrieb der neuen Anlage vollständig in eigener Hand zu behalten – inklusive Herstellung und Verarbeitung des Uranbrennstoffs. Das Land, einer der weltweit führenden Uranproduzenten, verfolgt damit eine langfristige Strategie zur Stärkung seiner Energieautonomie und zur Reduzierung seiner Abhängigkeit von fossilen Energieträgern.
 Die Regierung hat für 2025 einen klaren Fahrplan: Bis November soll ein zwischenstaatliches Abkommen mit Russland unterzeichnet werden, das den Bau und den künftigen Betrieb des Kernkraftwerks regelt. Bis 2050 will man in Kasachstan einen „atomaren Cluster“ entwickeln – ein umfassendes System aus Kraftwerken, Brennstoffproduktion und Forschungseinrichtungen. Begleitet wird das Vorhaben von Umwelt- und Sicherheitsprüfungen, öffentlichen Anhörungen und einer Überwachung durch die Internationale Atomenergieorganisation (IAEO).
Die Regierung hat für 2025 einen klaren Fahrplan: Bis November soll ein zwischenstaatliches Abkommen mit Russland unterzeichnet werden, das den Bau und den künftigen Betrieb des Kernkraftwerks regelt. Bis 2050 will man in Kasachstan einen „atomaren Cluster“ entwickeln – ein umfassendes System aus Kraftwerken, Brennstoffproduktion und Forschungseinrichtungen. Begleitet wird das Vorhaben von Umwelt- und Sicherheitsprüfungen, öffentlichen Anhörungen und einer Überwachung durch die Internationale Atomenergieorganisation (IAEO).
Der Bau des Kraftwerks ist nicht nur ein Meilenstein für die kasachische Energiepolitik, sondern auch ein Signal in der internationalen Arena. Die enge Kooperation mit Russland unterstreicht die seit Sowjetzeiten bestehenden wirtschaftlichen Verbindungen, während Kasachstan zugleich seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit weiteren Partnern wie China, Südkorea und Frankreich betont.
Kernenergie und Klimaschutz
Befürworter verweisen darauf, dass Kernkraftwerke im laufenden Betrieb nahezu kein Kohlendioxid ausstoßen und daher als klimafreundliche Alternative zu Kohle- oder Gaskraftwerken gelten. Auch über den gesamten Lebenszyklus – vom Bau über die Brennstoffherstellung bis zum Rückbau – bleibt der CO₂-Fußabdruck deutlich unter jenem, der beim Betreiben von Kraftwerken mit fossilen Energieträgern entsteht, und ist daher eher vergleichbar mit dem CO₂-Fußabdruck von Windkraftanlagen. Zudem können Kernkraftwerke unabhängig von Wetter und Tageszeit konstant große Mengen Strom liefern und so erneuerbare Energien stabil ergänzen.
Kritiker hingegen warnen vor den ungelösten Problemen der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle und den potenziell katastrophalen Folgen schwerer Unfälle, wie sie in Tschernobyl und Fukushima geschehen sind. Hinzu kommen die hohen Baukosten und langen Projektlaufzeiten.
Mit dem Projekt will Kasachstan dennoch die wachsende Stromnachfrage infolge von Industrialisierung und Bevölkerungswachstum decken und zugleich seinen CO₂-Ausstoß senken. Der symbolische Akt am 8. August steht damit am Anfang eines ehrgeizigen Vorhabens: den Einstieg in eine klimafreundlichere, zugleich strategisch selbstbestimmte Energiezukunft.