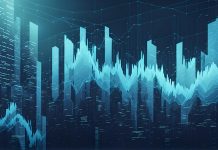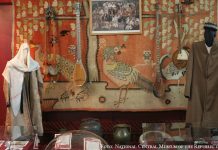Am vergangenen Montag trennten sich Nordmazedonien und Kasachstan in der Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft 2026 mit einem 1:1-Unentschieden. Dieses Ergebnis besiegelte wohl endgültig das Schicksal der kasachischen Auswahl in diesem Turnierzyklus. Die Chancen auf den Einzug in die Play-offs oder gar auf eine direkte Qualifikation sind damit praktisch auf Null gesunken. Schon zuvor hatte Kasachstan in der laufenden Kampagne schwache Leistungen gezeigt: Niederlagen gegen Wales, ein deutliches Defizit bei Torschüssen und nur wenige erzielte Treffer. In der Tabelle der Gruppe J belegt die Mannschaft einen der unteren Plätze – weit entfernt von der Spitzengruppe.
Der Weg durch die Qualifikation
 Um die Ursachen für das Scheitern besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf den Verlauf der Qualifikation. Kasachstan tritt – wie bereits seit einigen Jahren – im europäischen UEFA-Verband an. Schon der Auftakt verlief schleppend: Selbst gegen Mannschaften mit mittleren oder schwächeren Niveaus konnte das Team nur selten überzeugen. Meist reichte es nur zu knappen Siegen oder einem Unentschieden, während die Partien gegen stärkere Gegner stets verloren gingen. Selbst gegen ebenbürtige Teams gelang es den kasachischen Fußballrecken selten, das Spiel zu kontrollieren. Probleme in der Offensive, eine schwache Chancenverwertung und mangelnde personelle Stabilität prägten die Auftritte.
Um die Ursachen für das Scheitern besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf den Verlauf der Qualifikation. Kasachstan tritt – wie bereits seit einigen Jahren – im europäischen UEFA-Verband an. Schon der Auftakt verlief schleppend: Selbst gegen Mannschaften mit mittleren oder schwächeren Niveaus konnte das Team nur selten überzeugen. Meist reichte es nur zu knappen Siegen oder einem Unentschieden, während die Partien gegen stärkere Gegner stets verloren gingen. Selbst gegen ebenbürtige Teams gelang es den kasachischen Fußballrecken selten, das Spiel zu kontrollieren. Probleme in der Offensive, eine schwache Chancenverwertung und mangelnde personelle Stabilität prägten die Auftritte.
In der entscheidenden Phase ließ die Mannschaft oft wertvolle Punkte liegen: so entstanden die Niederlagen gegen Wales und Nordmazedonien sowie diverse verpasste Gelegenheiten in Heimspielen, was letztlich eine bessere Ausgangsposition für die Equipe verhinderte. Angesichts begrenzter personeller, infrastruktureller und organisatorischer Ressourcen konnte Kasachstan in der Schlussphase der Qualifikation keine Konstanz zeigen.
Statistisch fällt das Ergebnis ernüchternd aus: Der Durchschnittswert erzielter Tore liegt bei etwa 0,3 pro Spiel – einer der schwächsten in der gesamten Qualifikation. Fehlende Durchschlagskraft, mangelnde Kreativität im Angriff und kaum Druck auf den Gegner machten sich deutlich bemerkbar.
Ursachen des Scheiterns
Die Gründe für das Aus sind vielschichtig. Noch immer fehlt es in Kasachstan an modernen Fußballanlagen: 2024 gab es landesweit rund 220 Fußballfelder, aber nur 28 vollwertige Stadien. Während der langen Wintermonate müssen viele Mannschaften, einschließlich der Nationalelf, in Turnhallen oder auf kleinen Kunstrasenplätzen trainieren – das sind Bedingungen, die kaum eine professionelle Vorbereitung erlauben.
Hinzu kommt der Mangel an hochqualifizierten Trainern. Nur ein kleiner Teil der Übungsleiter verfügt über fortgeschrittene Lizenzen oder internationale Erfahrung. Auch gibt es in vielen Landesteilen nur eine unzureichende Anzahl von Ausbildungszentren, Trainingsakademien und Plätze mit Naturrasen. Der Pool an Spielern, die sich international behaupten können, ist begrenzt. Nur wenige kasachstanische Profis spielen in europäischen Ligen, was die Tiefe des Kaders einschränkt. Verletzungen oder Formschwankungen lassen sich schwer ausgleichen. Zwar rücken immer wieder junge Talente nach – etwa Dastan Satpajew, der bereits mit 16 Jahren debütierte –, doch fehlt es ihnen an Erfahrung auf hohem Niveau.
Auch die taktische Instabilität spielt eine Rolle: häufige Systemwechsel und Trainerrochaden verhindern, dass sich ein eingespieltes Teamgefüge bildet. Dazu kommt, dass das Niveau der Gegner in der UEFA meist deutlich höher ist als in der heimischen Liga, in der die Wettbewerbsintensität vergleichsweise gering bleibt. Der Sprung zu internationalen Spielen ist für viele Akteure schlicht zu groß.
Lehren und Perspektiven
Was kann sich ändern? Zunächst braucht es Investitionen in Infrastruktur: neue Plätze, moderne Akademien und Trainingszentren, besonders außerhalb der großen Städte. Ebenso wichtig ist eine professionelle Wintervorbereitung mit geeigneten Hallen und Kunstrasenfeldern. Die Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung von Trainern sollte zu einem zentralen Schwerpunkt werden.
Darüber hinaus wäre eine einheitliche Spielphilosophie von der Jugend bis zur A-Nationalmannschaft sinnvoll, um Talente gezielt auf den internationalen Wettbewerb vorzubereiten. Junge Spieler sollten regelmäßig Spielpraxis erhalten, auch wenn das kurzfristig Risiken birgt. Kontinuität auf der Trainerbank ist ebenfalls entscheidend – langfristige Projekte brauchen Zeit, um Früchte zu tragen.
Ein weiterer Punkt ist die psychologische Stabilität: Kasachstanische Spieler müssen lernen, Rückstände aufzuholen und auch in schwierigen Spielphasen fokussiert zu bleiben. Gleichzeitig sollte der Verband enger mit führenden Klubs wie dem FC Kairat zusammenarbeiten, um deren Know-how und professionelle Strukturen auf die Nationalmannschaft zu übertragen.
Schließlich könnte eine stärkere Einbindung von Sponsoren und Investoren helfen, den finanziellen Spielraum zu erweitern und bessere Bedingungen für Vorbereitung und Reisen zu schaffen.
Die WM-Qualifikation hat erneut die strukturellen Schwächen des kasachischen Fußballs offengelegt. Trotz einer wachsenden Begeisterung im Land und vereinzelter Erfolge bleibt die Nationalmannschaft gefangen in alten Mustern – begrenzte Infrastruktur, fehlende Fachkräfte und eine inkonsistente Nachwuchsarbeit bremsen den Fortschritt.
Während Klubs wie Kairat Almaty zeigen, dass mit professionellem Management, Disziplin und langfristiger Planung der Weg in die europäische Spitze möglich ist, sucht die Nationalmannschaft noch nach ihrer Identität. Der Erfolg einzelner Vereine beweist, dass das Potenzial vorhanden ist, aber entscheidend wird sein, ob es der Verband und die sportliche Führung schaffen, diese Erfahrungen auf die Ebene der Nationalelf zu übertragen. Erst dann wird ein Unentschieden in Skopje nicht länger Symbol eines verpassten Traums sein.