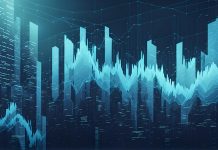Ella Tschitschigin ist in Kasachstan geboren, in Deutschland aufgewachsen und bewegt sich heute sicher zwischen der deutschen, der russischen und der kasachischen Kultur. Im Interview spricht sie über ihre Kindheit als Spätaussiedlerin, über den schwierigen Brückenschlag zwischen Mehrheitsgesellschaft und deutscher Minderheit und darüber, warum ihre Arbeit beim ifa – Institut für Auslandsbeziehungen für sie mehr als nur ein Job ist.
Liebe Ella, kannst du etwas über deine Kindheit in Kasachstan erzählen und auch sagen, wie alt du damals warst und welche prägenden Erfahrungen du gemacht hast?
Ich wurde in Schachtinsk geboren, einer Stadt im Gebiet Karaganda, in welcher der Kohlebergbau das Leben der Menschen bestimmt. 2003, als ich vier Jahre alt war, sind wir nach Deutschland übergesiedelt – relativ spät, wenn man bedenkt, dass die größten Ausreisephasen der Kasachstandeutschen in den 1980er und 1990er Jahren lagen.
Meine Eltern hatten ursprünglich gar nicht geplant, nach Deutschland zu ziehen. Meine Mutter ist russischer Herkunft, sie war aus Omsk nach Schachtinsk übergesiedelt und sie hatte keinerlei Verbindung zur deutschen Minderheit oder zu Deutschland. Mein Vater stammt zwar aus einer Familie der deutschen Minderheit, wurde aber selbst überwiegend russisch erzogen. Seine Mutter und ihre Familie wiederum gehörten zur deutschen Minderheit, sein Vater war Russe.
Meine deutschen Wurzeln gehen also auf meine Urgroßeltern väterlicherseits zurück. Meine Urgroßmutter, auch sie hieß Ella und von ihr habe ich meinen Namen erhalten, wurde in einem deutschen Dorf an der Wolga geboren, mein Urgroßvater Christian Buchmüller aber kam in Kalmückien zur Welt. Nach der erzwungenen und gewaltsamen Umsiedlung während des Krieges lernten sich die beiden in einem Arbeitslager im Ural kennen, wo auch meine Großmutter väterlicherseits geboren wurde. Später zog die Familie nach Kirgisistan, dann nach Kasachstan. 2001 kamen meine Urgroßeltern nach Deutschland, wir folgten 2003.
 Der Grund für die Ausreise nach Deutschland war die schwierige Lage nach dem Zerfall der Sowjetunion: In unserer Region gab es im Winter oft keine Heizung, die Gehälter wurden nicht ausgezahlt, die Lebensmittel waren knapp, und die Sicherheitslage war schlecht. Bei Temperaturen von minus 40 Grad war es so fast unmöglich, die Kinder warm zu halten.
Der Grund für die Ausreise nach Deutschland war die schwierige Lage nach dem Zerfall der Sowjetunion: In unserer Region gab es im Winter oft keine Heizung, die Gehälter wurden nicht ausgezahlt, die Lebensmittel waren knapp, und die Sicherheitslage war schlecht. Bei Temperaturen von minus 40 Grad war es so fast unmöglich, die Kinder warm zu halten.
Ich selbst habe nur wenige Erinnerungen an Kasachstan. Meine Schwester, die damals elf war, erlebte die Umstellung viel bewusster. Wir konnten beide kein Deutsch – sie wurde sofort eingeschult, ich kam in den Kindergarten. Dort saß ich anfangs oft allein in einer Ecke und weinte, weil ich die anderen Kinder nicht verstand. Meine Eltern konnten nach drei bis sechs Monaten arbeiten, ihre Abschlüsse wurden aber bis heute nicht anerkannt. Man machte ihnen deutlich, dass sie nur aus einem einzigen Grund hier seien: zum Arbeiten – ohne Ansprüche und ohne Klagen. Fortan bestand – und besteht bis heute – ihr Leben genau aus diesem einen.
Für mich war die Integration einfacher als für meine Schwester, da ich jünger war und schnell Deutsch lernte. Trotzdem fiel mir auf, dass ich „anders“ war: Meine Kleidung, unser Essen – Blini statt Pausenbrot – und die Sprache zu Hause unterschieden sich von dem, was bei meinen Freunden üblich war.
Inwieweit hat deine Herkunft deine Sicht auf Heimat und Zugehörigkeit geprägt?
Ich trage drei Kulturen in mir: die deutsche, weil ich den Großteil meines Lebens hier in Deutschland verbracht habe, die kasachische, weil ich in Kasachstan geboren wurde und enge Verwandte dort habe, und die russische, weil wir bis heute zu Hause Russisch sprechen und viele russisch geprägte Traditionen pflegen.
Ich kann keinen einzigen Ort klar als „Heimat“ benennen. Russland ist es nicht, Kasachstan auch nicht – aber eher noch als Russland –, Deutschland ebenfalls nicht vollständig. Manchmal fühle ich mich „deutsch genug“, wie es Ira Peter in ihrem aktuellen Buch sehr gut beschreibt, etwa wenn es um Effizienz und Arbeitsethik geht. Andererseits habe ich viele typisch deutsche Bräuche wie den Karneval oder das Oktoberfest nie erlebt und mich auch nicht in Vereinen engagiert. Ich bin eine Mischung aus allen drei Kulturen – nicht zu 100 Prozent das eine und nicht zu 100 Prozent das andere.
Du bist beim ifa für die Stipendienprogramme der deutschen Minderheiten in Osteuropa und Zentralasien zuständig. Wie bist du zu dieser Stelle gekommen?
 2024 habe ich meinen Master an der Universität Bologna abgeschlossen. Dann bin ich zurück gegangen nach Rottweil und suchte dort nach passenden Stellen – das ist in meiner südbadischen Region überhaupt nicht einfach, wenn man im Bereich Politik und internationale Beziehungen arbeiten möchte. Beim ifa, dem Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart und Berlin, stieß ich letztlich auf eine Ausschreibung im Arbeitsbereich der Förderung deutsche Minderheiten.
2024 habe ich meinen Master an der Universität Bologna abgeschlossen. Dann bin ich zurück gegangen nach Rottweil und suchte dort nach passenden Stellen – das ist in meiner südbadischen Region überhaupt nicht einfach, wenn man im Bereich Politik und internationale Beziehungen arbeiten möchte. Beim ifa, dem Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart und Berlin, stieß ich letztlich auf eine Ausschreibung im Arbeitsbereich der Förderung deutsche Minderheiten.
Was ist das Ziel der Stipendienprogramme, und wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Das Ziel dieser Stipendien ist es, die deutschen Minderheiten zu unterstützen und gleichzeitig junge Menschen für ein größeres Engagement für gesellschaftliche Belange zu gewinnen. Dafür gibt es verschiedene Programme.
Das Kulturassistenzprogramm ist eine projektbezogene Förderung, bei dem Institutionen der deutschen Minderheiten in Osteuropa und Zentralasien Projektideen einreichen können, für die sie junge, engagierte Personen suchen. Diese Projekte sind oft sehr individuell und reichen von kulturellen Veranstaltungen über Bildungsangebote bis hin zu kreativen Medienprojekten. Gefördert wird dabei nicht nur die Umsetzung der Projekte, sondern auch die persönliche und fachliche Qualifizierung der Teilnehmenden – zum Beispiel im Projektmanagement oder in der Öffentlichkeitsarbeit. Zudem werden die Stipendiatinnen und Stipendiaten zu Fortbildungen eingeladen, bei denen sie sich untereinander vernetzen und von den Erfahrungen anderer profitieren können.
Das Hospitationsprogramm richtet sich an Einzelpersonen aus den deutschen Minderheiten, die bereits in einer Organisation tätig sind – sei es haupt- oder ehrenamtlich. Sie hospitieren für einen bestimmten Zeitraum in einer anderen Organisation der deutschen Minderheiten, oft auch in einem anderen Land, um neue Arbeitsmethoden und bewährte Verfahren kennenzulernen. Dieses Programm ist besonders wertvoll, weil jede deutsche Minderheit ihre eigene Geschichte, Struktur und Arbeitsweise hat und weil so ein Austausch oft zu ganz neuen Ideen führt, die anschließend in der eigenen Organisation umgesetzt werden können.
Das Talentstipendium ist ein neues Format, das erst in diesem Jahr ins Leben gerufen wurde und aus Mitteln der Familienstiftung „Geschwister Ilse und Werner Lechtenberg“ finanziert wird. Es ist ein besonderes Angebot für ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten des ifa, die sich in einem speziellen Bereich vertieft weiterbilden möchten. Dabei können sie selbst kreativ gestalten, wie diese Weiterbildung aussieht – etwa durch die Teilnahme an Seminaren, Coachings oder Schulungen. Wichtig ist, dass das erworbene Wissen bzw. ihr gefördertes „Talent“ später wieder in die Arbeit der deutschen Minderheiten einfließt. In diesem Jahr sind es beispielweise drei Stipendiatinnen, darunter eine aus Ungarn, die ein Talent für Film- und Animationserstellung besitzt und es ausbauen möchte, um die deutsch-ungarische Literatur durch filmische Arbeiten, also durch Filme und Animationen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
In meinem Arbeitsalltag bin ich für die Koordination dieser Programme zuständig. Ich veröffentliche Ausschreibungen, prüfe Bewerbungen, halte Kontakt zu den Organisationen in den verschiedenen Ländern, organisiere Auswahlgespräche, begleite die Stipendiatinnen und Stipendiaten während ihrer Projekte und plane Fortbildungs- und Vernetzungstreffen. Dazu gehört viel organisatorische Detailarbeit– von der Abstimmung mit Kolleginnen und Kollegen bis zur Bearbeitung von Förderanträgen und Berichten. Besonders spannend finde ich den direkten Austausch mit den Teilnehmenden, weil ich so Einblicke in die Arbeit und Lebensrealität der deutschen Minderheiten vor Ort erhalte.
Wie würdest du den aktuellen Austausch zwischen Deutschland und den deutschen Minderheiten im östlichen Europa und in Zentralasien beschreiben?
Auf politischer Ebene gibt es in Deutschland eine große Wertschätzung – hier werden die deutschen Minderheiten als Brückenbauer bezeichnet und gesehen. Persönlich habe ich jedoch das Gefühl, dass viele in Deutschland lebende Deutsche kaum Kenntnisse über die deutschen Minderheiten im Ausland haben. Dabei ist es so spannend und bereichernd. In meiner Arbeit erlebe ich den Austausch als sehr dynamisch, besonders in Zentraleuropa. Die Vernetzung ist sowohl innerhalb der Länder als auch über Grenzen hinweg stark – was sich in vielen Formaten wie dem jährlichen Sommercamp oder länderübergreifenden Jugendbegegnungen zeigt.
Ganz besonders ist für mich der Kontakt zu deutschen Minderheiten in Zentralasien, im Südkaukasus oder in der Republik Moldau. Mit dem zahlenmäßigen Rückgang der älteren Generation sowie durch die Abwanderung der Jüngeren verliert die deutsche Minderheit dort zunehmend an Bedeutung – ebenso wie die deutsche Sprache. Das macht die Ansprache und Vernetzung neben der geografischen Distanz deutlich schwieriger.
Welchen Rat würdest du jungen Menschen geben, die wie du mit mehreren Kulturen aufwachsen?
Stellt möglichst früh möglichst viele Fragen in der Familie! Ich bedaure es zutiefst, dass ich meine Urgroßmutter nicht mehr nach ihren Erlebnissen und Erfahrungen fragen konnte. Als Uroma Ella starb, war ich gerade mal 13 Jahre alt. In diesem Alter hatte ich noch kein wirkliches Verständnis für meine Herkunft und sie hat mich auch nicht besonders tangiert.
Es ist einfach bedauerlich, dass so viele Geschichten verloren gehen, weil die älteren Generationen oft nicht darüber sprechen können oder wollen. Persönlich betroffen macht mich, dass sie nie Gerechtigkeit – beispielsweise in Form von Entschädigungen – erhalten haben für das, was ihnen widerfahren ist. Deshalb würde ich empfehlen, sich vorsichtig heranzutasten und den Urgroßeltern eine Stimme zu geben. Ich bin mir sicher, dass viele Familienangehörige sich nach und nach öffnen werden und darüber erzählen. Ich für meinen Teil sehe meine Herkunft als Stärke: Man entwickelt ein besonderes Gespür für Menschen aus verschiedenen Kulturen, man kann eine etwaige Diskriminierung deutlich sensibler einordnen und hat bestenfalls sogar noch ein besonderes Talent für Sprachen. Wichtig ist, sich nicht von starren Definitionen verunsichern zu lassen. Man muss sich nicht zu 100 Prozent einer einzigen Kultur zugehörig fühlen. Für mich ist diese Mischung ein Gewinn.