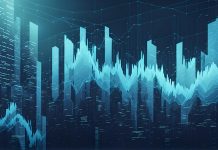Wer am 30. Oktober den Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie betrat, wurde von einer Atmosphäre empfangen, in der sich Orient und Okzident die Hand reichten. Das usbekische Orchester für Volksinstrumente „Sogdiana“ versammelte auf einer Bühne Meisterinnen und Meister aus Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, Turkmenistan und der Türkei – vereint von der Idee, die Seidenstraße mit Musik wieder lebendig werden zu lassen.
Eine Wiege der Kulturen
Zentralasien, das Herz der alten Seidenstraße, erstreckt sich von Russland bis nach China und Afghanistan und ist Heimat einer vielfältigen Kulturgeschichte. Schon im antiken Sogdiana mit seiner legendären Hauptstadt Samarkand verschmolzen Handelswege und musikalische Traditionen. Hier wurden nicht nur Stoffe und Waren getauscht, sondern auch Klänge, Instrumente und Rhythmen – was archäologische Funde von Terrakotta-Lautenspielern eindrucksvoll belegen. In dieser hochentwickelten musikalischen Landschaft waren Ensemble-Spiel und Vielstimmigkeit von jeher Ausdruck kultureller Raffinesse.
Sogdiana als Bewahrer und Innovator
Das 1991 im Jahr der usbekischen Unabhängigkeit gegründete Ensemble trägt seinen Namen bewusst als Hommage an das reiche musikalische Erbe der Region. Das Orchester wurde von Anvar Hakimovich Liviev – einem Pionier auf dem Gebiet traditioneller Instrumente – und der Dirigentin Firyuza Ravshanovna Abdurakhimova gegründet und mit diesem Ensemble formten sie eine Klanggemeinschaft, die das vielfältige volksmusikalische Erbe Usbekistans weiterentwickelt und in zeitgemäßer Ästhetik präsentiert. Beim Berliner Konzert sorgte Abdurakhimova gemeinsam mit Kahramon Bazarov für virtuose Leitung und eine Atmosphäre, in der Tradition und Gegenwart verschmolzen.
Heute steht „Sogdiana“ sinnbildlich für den neuen Aufbruch einer gesamten Region. Das Orchester wurde vielfach international ausgezeichnet und stellt eine Bühne für starke individuelle Stimmen dar: Alle 18 Musikerinnen und Musiker sind herausragende Solistinnen und Solisten, die etwa 20 verschiedene traditionelle Instrumente – darunter Rubab, Dutar, Ud, Nay, Surnay, Koshnay oder Chang – meisterhaft beherrschen.
Hinter den Kulissen des Festivals
Gleich zu Beginn würdigten prominente Ehrengäste die Bedeutung des Abends. Nikolaus Rexroth, künstlerischer Leiter des Festivals „Into the Open“, unterstrich seine Freude, mit dieser Veranstaltung das vielstimmige Festivaljahr abzuschließen – ein Festival, das Brücken baut zwischen den Genres, Grenzen und Kulturen und das Musikliebhaber*innen quer durch Europa miteinander in Resonanz bringt.
Winfried Wohlfeld, Gründer und Vorsitzender der Stiftung am Grunewald, eröffnete seine Ansprache mit einer persönlichen Geschichte: Inspiriert vom Engagement einer jungen kasachischen Musikerin, die mit viel Herzblut auf ihn zuging und eine Förderung für dieses außergewöhnliche Projekt einwarb – ein Beispiel für gelebte kulturelle Leidenschaft. Dank dieser Initiative konnten Musikerinnen und Musiker aus sechs Ländern für ein gemeinsames Erlebnis gewonnen werden. Wohlfeld würdigte ausdrücklich die Gastfreundschaft der usbekischen Botschaft, welche die Proberäume zur Verfügung gestellt hatte, sowie die Unterstützung der Ministerien bei Reisekosten. Für ihn grundiert all das die Botschaft: In Berlin ist diese Musik herzlich willkommen.
Internationalen Rahmen verlieh Sultan Raev, Generalsekretär von TURKSOY, dem Abend: Er hob die Musik als universelle Brücke hervor, die neue Freundschaften stiftet und das gemeinsame kulturelle Erbe der Seidenstraße lebendig hält – ein Erbe, das als Schatz der Menschheit verstanden werden darf.
Vielstimmigkeit und Grenzgänge
Das Orchester ließ auf der Bühne Werke beinahe epischer geografischer und stilistischer Spannweite entstehen: Abschnitte des kirgisischen Heldenepos „Manas“, das usbekische Folklore-Genre „Mavrigi“ aus Buchara, turkmenische Melodien über das Leben Magtymguly Pyragis, das kasachische Stück „Bulbul“, Opern-Ouvertüren wie „Köroglu“ oder die Arie „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ von Franz Lehár. Mit besonderer Raffinesse wurden Werke aus dem westlichen Kanon – Bach, Mozart, Beethoven – auf traditionellen zentralasiatischen Instrumenten interpretiert. So entstand ein Klangbild, das ostasiatische Tonfarben mit abendländischer Harmonik verschmelzen ließ.
Überraschungsmomente gab es auch für das Berliner Publikum, wenn etwa ein Tanzensemble auf die Bühne trat – Gesten und Bewegungen, die ganz selbstverständlich zur zentralasiatischen Aufführungskultur gehören, im klassischen Konzertsaal aber als erfrischender „Normenbruch“ wahrgenommen werden.
Resonanz und Ausblick
Das Publikum war so vielseitig wie das Programm selbst: Menschen verschiedenster Herkunft schufen eine Atmosphäre kollektiver Begeisterung. Der Abend zeigte, dass Austausch weit über Applaus und Zuhören hinausgeht, aber ebenso auch, dass Musik zum Erleben, Mitmachen, manchmal auch zum Tanzen einlädt. Im Miteinander von Nostalgie und Neugier lag die Magie dieses Austauschs: Für einen Teil war es Heimkehr, für den anderen ein Ausflug in unbekannte Welten.
Dieser Abend in der Philharmonie war letztlich mehr als ein Konzert: Er wurde zum Fixpunkt auf einer neuen musikalischen Landkarte entlang der Seidenstraße – beseelt vom Geist gegenseitiger Inspiration und von der Offenheit für Neues. Zentralasiatische Musikerinnen und Musiker haben sich an diesem Abend einen großen Platz auf der europäischen Bühne erspielt – ein Schritt, der neugierig macht auf weitere Begegnungen.