Die Geschichte der lutherischen Kirche in Kasachstan hat tiefe Wurzeln. Die ersten lutherischen Gemeinden auf dem Gebiet Kasachstans lassen sich bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. In den Jahren der Repressionen wurde fast das gesamte Pastorat der Kirche ausgelöscht. Erst 1957 wurde die lutherische Gemeinde wieder offiziell zugelassen – die erste nach der Zerschlagung der Kirche in den Sowjetjahren.
Der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Republik Kasachstan, Rostislaw Nowgorodow, berichtete ausführlich über die Geschichte der lutherischen Gemeinde und der Kirche in Kasachstan. Er sprach mit der DAZ auch über die ethnische Vielfalt der Gemeindemitglieder und die heutige Tätigkeit der Kirche.
Die erste lutherische Gemeinde nach der Zerschlagung der Kirche während der Repressionen
 „Der erste Pastor, über den es in den Archivdokumenten unserer Republik Aufzeichnungen gibt, ist wahrscheinlich Eugen (Evgenij) Bachman. Nach seiner Entlassung aus dem Lager kam er nach Akmola und betrachtete diesen Ort fortan als sein Zuhause. Er hielt die ersten geheimen Versammlungen ab. Solche Treffen gab es natürlich auch in Karaganda und an anderen Orten“, erzählt Bischof Rostislaw. Irgendwann wurde Kasachstan zur protestantischsten Republik der Sowjetunion. Hier lebten die meisten Deutschen. Und genau hier wurde dank Bachman die lutherische Kirche offiziell registriert. „Nicht in Leningrad, nicht in Moskau zu dieser Zeit, sondern genau in Akmola, in unserem Kasachstan“, betont der Bischof.
„Der erste Pastor, über den es in den Archivdokumenten unserer Republik Aufzeichnungen gibt, ist wahrscheinlich Eugen (Evgenij) Bachman. Nach seiner Entlassung aus dem Lager kam er nach Akmola und betrachtete diesen Ort fortan als sein Zuhause. Er hielt die ersten geheimen Versammlungen ab. Solche Treffen gab es natürlich auch in Karaganda und an anderen Orten“, erzählt Bischof Rostislaw. Irgendwann wurde Kasachstan zur protestantischsten Republik der Sowjetunion. Hier lebten die meisten Deutschen. Und genau hier wurde dank Bachman die lutherische Kirche offiziell registriert. „Nicht in Leningrad, nicht in Moskau zu dieser Zeit, sondern genau in Akmola, in unserem Kasachstan“, betont der Bischof.
Die Kirche befand sich damals in der Bayanaul-Straße, im alten Teil von Astana. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Abwanderung der Deutschen aus Kasachstan befürchteten viele, dass mit ihnen auch die Kirche verschwinden würde. „Aber wie sich herausstellte, tauchten immer noch Menschen auf. Nicht alle sind weggegangen. Es kamen neue Menschen, und zwar nicht nur Deutsche.“
Im Jahr 2017 wurde dann die neue Kirche der Evangelisch-Lutherischen Kirche Kasachstans eröffnet und geweiht.
„Diese Kirche ist in ihrer Art einzigartig“, betont Bischof Rostislaw. „Für die gesamte protestantische Kirche in Kasachstan ist sie eine Art Symbol. Denn es ist die einzige klassische lutherische Kirche im Land, deren Gebäude von Anfang an als Kirche gebaut wurde.“
Er präzisiert, dass die übrigen Gebetshäuser Gebäude nutzen, die einst Wohnhäuser, Schulen oder Verwaltungsgebäude waren. Einige von ihnen wurden später umgebaut und erhielten das Aussehen einer Kirche. Aber das heutige Gebäude ist etwas Besonderes: „Es wurde von Grund auf als Kirche konzipiert und erbaut. Und auch wenn es innen streng und ziemlich leer aussieht, liegt genau darin der Sinn: Nichts lenkt vom Zentrum der Theologie ab.“
Was ist das Besondere an dem jährlichen Gebet für die Opfer der Deportation?
Während des jährlichen Gebets zum Gedenken an die Deportation füllt sich die Kirche mit Namen, die laut ausgesprochen werden. Die Menschen teilen das Kostbarste, was sie haben – die Erinnerung an ihre Angehörigen. „Manche nennen einfach nur den Vor- und Nachnamen“, bemerkt Bischof Rostislaw. „Manche fügen hinzu: „Das ist meine Großmutter“ oder „Das war mein Vater“. Und wissen Sie, das verbindet die Menschen auf erstaunliche Weise und spendet Trost. Man spürt, dass man unter Menschen ist, die dasselbe erlebt haben wie man selbst.“
Er erklärt, dass die Zeremonie längst über die Grenzen der deutschen Gemeinde hinausgewachsen ist. „Es ist wichtig, dass die Menschen nicht kommen, weil dort ‚Gesellschaft der Deutschen‘ steht“, sagt Bischof Rostislav. „Sie kommen, weil auch sie sich dieser Erinnerung verbunden fühlen. Und das fördert eine Kultur, die nicht in sich geschlossen ist, sondern offen für andere.“
Über das Museum der ersten Gemeindemitglieder der Kirche
 „Es ist sehr schade, dass mein Vater so früh verstorben ist (Emeritierter Erzbischof Yurii Nowgorodow – Anm. der Redaktion). Er hatte vor, ein Museum einzurichten, aber leider hat er es nicht mehr geschafft. Jetzt plane ich, es einzurichten. Wir haben bereits Material dafür. Darunter sind alte Bücher, einige sogar aus dem 19. Jahrhundert. Doch sie sind nur wie Ausstellungsstücke. Ich hätte gerne noch mehr Erinnerungen von Menschen“, teilt Bischof Rostislaw seine Pläne mit.
„Es ist sehr schade, dass mein Vater so früh verstorben ist (Emeritierter Erzbischof Yurii Nowgorodow – Anm. der Redaktion). Er hatte vor, ein Museum einzurichten, aber leider hat er es nicht mehr geschafft. Jetzt plane ich, es einzurichten. Wir haben bereits Material dafür. Darunter sind alte Bücher, einige sogar aus dem 19. Jahrhundert. Doch sie sind nur wie Ausstellungsstücke. Ich hätte gerne noch mehr Erinnerungen von Menschen“, teilt Bischof Rostislaw seine Pläne mit.
Er präzisiert, dass viele der Gemeindemitglieder aus früheren Zeiten, die die Deportationen überlebt haben und in Waggons nach Kasachstan gebracht wurden, noch am Leben sind. Gerade bei ihnen wäre es am interessantesten, um sie über die Geschichte der Gemeinde zu befragen. Mit ihnen könnte man sprechen und diese Fragen aus erster Hand erforschen.
Unter den Gemeindemitgliedern sind heute längst nicht nur Deutsche
Obwohl die Kirche keine genauen Statistiken über die ethnische Zugehörigkeit ihrer Gemeindemitglieder führt, weist der Bischof auf deren ethnische Vielfalt hin: „Heute ist die Kirche natürlich nicht mehr zu hundert Prozent deutsch. Ich denke, vielleicht sind mehr als die Hälfte Deutsche. Aber die andere knappe Hälfte sind all jene, die ebenfalls in Kasachstan leben. Selbst ich bin kein Deutscher, sondern Russe.“ Der Bischof fügt hinzu: Unter den Geistlichen gibt es beispielsweise auch Kasachen.
Manchmal, so fügt er mit einem Lächeln hinzu, sprechen sogar diejenigen, die nicht deutscher Nationalität sind, im Gottesdienst Deutsch. „Wir haben ein kasachisches Gemeindemitglied, das besser Deutsch spricht als manche Deutsche. Er kommt, weil es ihm Freude macht, sich in dieser Sprache zu unterhalten.“
Die Rolle der deutschen Sprache
 In der Sowjetzeit, als es noch keine Kulturzentren gab, war es gerade die Kirche, die zu einem solchen Ort der Kommunikation wurde. „Jemand sagte einmal: ‚Warum kommen sie hierher, sie kommen doch nicht zu Gott, sie wollen nur Deutsch sprechen.‘ Ein anderer Pfarrer antwortete: ‚Nun, gegenüber ist die Bierstube Bavaria. Aber sie sind nicht dorthin gekommen, um Deutsch zu sprechen, sondern genau hierher.‘ Und darin liegt der Sinn.“
In der Sowjetzeit, als es noch keine Kulturzentren gab, war es gerade die Kirche, die zu einem solchen Ort der Kommunikation wurde. „Jemand sagte einmal: ‚Warum kommen sie hierher, sie kommen doch nicht zu Gott, sie wollen nur Deutsch sprechen.‘ Ein anderer Pfarrer antwortete: ‚Nun, gegenüber ist die Bierstube Bavaria. Aber sie sind nicht dorthin gekommen, um Deutsch zu sprechen, sondern genau hierher.‘ Und darin liegt der Sinn.“
Was die Rolle der deutschen Sprache angeht, so ist es, wie der Bischof bemerkte, für viele ältere Gemeindemitglieder nach wie vor wichtig, dass die Gottesdienste in deutscher Sprache abgehalten werden. In Pawlodar beispielsweise werden deutsche Kirchenlieder gesungen. In Lissakowsk wurden die Gottesdienste lange Zeit vollständig in deutscher Sprache abgehalten. In Astana hingegen beschlossen die Gemeindemitglieder in den 90er Jahren, aufs Russische umzusteigen, weil die Jugend kein Deutsch mehr verstand. Aber wenn sie wollen, können die Menschen natürlich auch Deutsch sprechen.
Welche Feiertage sind für die Lutheraner in Kasachstan besonders wichtig?
„In erster Linie sind das Weihnachten und Ostern. Es gibt auch eigene lutherische Feiertage, zum Beispiel den Tag des Augsburger Bekenntnisses. Sehr beliebt ist auch das Erntedankfest – insbesondere in den Gemeinden, in denen die ländliche Tradition erhalten geblieben ist“, erzählt der Bischof.
Beziehungen zu anderen Religionsgemeinschaften in Kasachstan
 Die Kirche pflegt weiterhin sehr herzliche Beziehungen zu anderen Konfessionen. „Wir haben zu allen ein ausgezeichnetes Verhältnis“, betont Bischof Rostislaw. Die engsten Beziehungen bestehen zur orthodoxen und zur katholischen Kirche.
Die Kirche pflegt weiterhin sehr herzliche Beziehungen zu anderen Konfessionen. „Wir haben zu allen ein ausgezeichnetes Verhältnis“, betont Bischof Rostislaw. Die engsten Beziehungen bestehen zur orthodoxen und zur katholischen Kirche.
Am 17. September findet die nächste Sitzung des Synods statt, dem höchsten kirchlichen Gremium. Sie fällt mit dem achten Jahrestag der Eröffnung der Kirche zusammen. Zu diesem Anlass ist ein Festgottesdienst geplant.
Im Rahmen des Gottesdienstes findet auch ein Orgelkonzert statt. „Es wird Saltanat Abilchanowa spielen – eine hervorragende Musikerin. Es lohnt sich auf jeden Fall, dabei zu sein, wir laden alle herzlich ein“, fügt er hinzu.
Der Bischof betont, dass es gerade die Offenheit gegenüber verschiedenen Kulturen ist, die es der Kirche ermöglicht, lebendig zu bleiben. „Wir sind alle unterschiedlich. Ich bin Russe, ein anderer ist Kasache, jemand hat in Deutschland studiert, eine andere hier. Aber wenn ein Mensch offen ist, kann er immer etwas von den anderen lernen.“






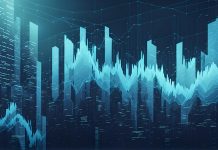


















Super gemacht, sehr zu empfehlen