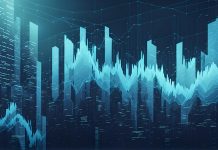Eine kopflose Ziege in den kasachischen Bergen – der Kern eines jahrhundertealten Wettstreits, der die Nomaden Zentralasiens vereint: Kokpar. Hier verschmelzen Kraft, Geschick und Mut mit Tradition. Ein Spiel, das die kriegerische Lebensweise der Nomaden verkörpert und die Identität der Kasachen bis heute prägt.
Staub wirbelt über den Wiesenboden, als das erste Pferd am Jurtencamp eintrifft. Nach und nach kommen weitere Reiter – wettergegerbte Schäfer, kräftige Bauern und deren Söhne, die als Seminomaden ihre Herden in den Ausläufern des Tian Shan südlich von Almaty hüten. Zwischen den Pferden mischen sich Frauen mit bunten Kopftüchern und aufgeregte Kinder. An diesem Mittag sind sie alle hier, um eine besondere Nomadentradition zu zelebrieren: Kokpar. Ein Spiel, ein Kampf, ein Fest, bei dem Geschick, Mut und Ausdauer zählen.
Die Recken – wie die Reiter genannt werden – sammeln sich im Kreis. In der Mitte: eine angebundene Ziege. Preis für den Sieger. Herzstück des Spiels. Stimmen werden lauter. Es wird hektisch, als zwei Männer vortreten und das Tier packen. Dann geht es schnell: ein kurzer, gezielter Schnitt, das Zittern des Körpers. Noch ehe ein unerfahrenes Auge begreift, was passiert ist, liegt der Kopf des Tiers beiseite.
Geschwindigkeit, Kraft und Chaos
Mit kräftigen Schwüngen greifen die Reiter vom Sattel aus nach dem schweren Körper – rund 40 Kilo, schlaff, unhandlich. Wer ihn erhascht, muss ihn im vollen Galopp in das gegnerische Tor tragen, das hier nichts weiter ist als einige grob in die Steppe gezogene Linien. Zwei Mannschaften bilden sich. Ein Schrei. Die Pferde setzen sich in Bewegung.
Was folgt, ist eine Mischung aus Chaos und Choreografie: Dutzende Hufe schlagen auf den Boden, Reiter drängen und stoßen sich, lehnen sich gefährlich weit aus den Sätteln, um den Kadaver zu entreißen. Mal entgleitet er einem, mal müssen die Zuschauer zur Seite springen, wenn das Getümmel zu nahekommt. Manchmal verschwinden Reiter und Pferde ganz hinter den Hügeln, nur um plötzlich wieder heranzupreschen.
Ein junger Mann sticht heraus: schlank, sehnig, blitzschnell. Schon beim ersten Angriff reißt er das Tier an sich, zieht es am Hinterbein in einer fließenden Bewegung auf den Sattel und heizt los. Lauter Beifall, als er den Körper ins gegnerische Tor legt. Drei weitere Male gelingt ihm das Kunststück. Dann folgt eine wilde Verfolgungsjagd. Der junge Recke hält die Beute fest und biegt ab. Er reitet weg vom Spielfeld, bergauf, hinter einen Kamm. Die Meute verschwindet.
„Er bringt die Ziege zu seiner Jurte“, ruft einer der älteren Männer. Damit ist klar: Der Sieger steht fest, das Spiel ist beendet. Wo eben noch die Hufen donnerten, bleibt nur ein roter Fleck im Gras. Die Ziege gehört nun ihm – als Essen, als Symbol seines Triumphs. Dazu gibt es ein Preisgeld, das hier von demjenigen bezahlt wird, der das Match ausgerufen hat. Sieg schmeckt doppelt.
Von der Steppe ins Stadion
Kokpar ist weit mehr als ein raues Reiterspiel. Es ist Ausdruck einer jahrhundertealten Kultur und spirituellen Identität, die Gemeinschaften jenseits von Alter, Herkunft oder sozialem Status verbindet. Wissen und Fertigkeiten werden meist durch Zuschauen, Nachahmen und gemeinsames Spiel weitergegeben. Doch was hier zwischen Bergen und Jurten tobt, ist längst auch ein offizieller Wettkampfsport und sogar der Nationalsport in Kasachstan und Kirgisistan.
In seiner modernen Form – bei nationalen Meisterschaften oder den World Nomad Games, den „Olympischen Spielen Zentralasiens“ – treten Teams von bis zu zwölf Männern an. Gespielt wird in Trikots mit Nummern, Stiefeln, Filzhut (Tebetey) und der Kamchy, der Reitpeitsche.
Obwohl die echte Ziege nach wie vor das Herzstück des Spiels bildet, gibt es inzwischen auch Varianten mit Gummikadaver, die den Wettkampf zugänglich für moderne Turniere machen. So bleibt Kokpar ein lebendiger Ausdruck einer jahrhundertealten Tradition, die in der modernen Welt neue Formen gefunden hat.