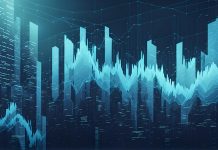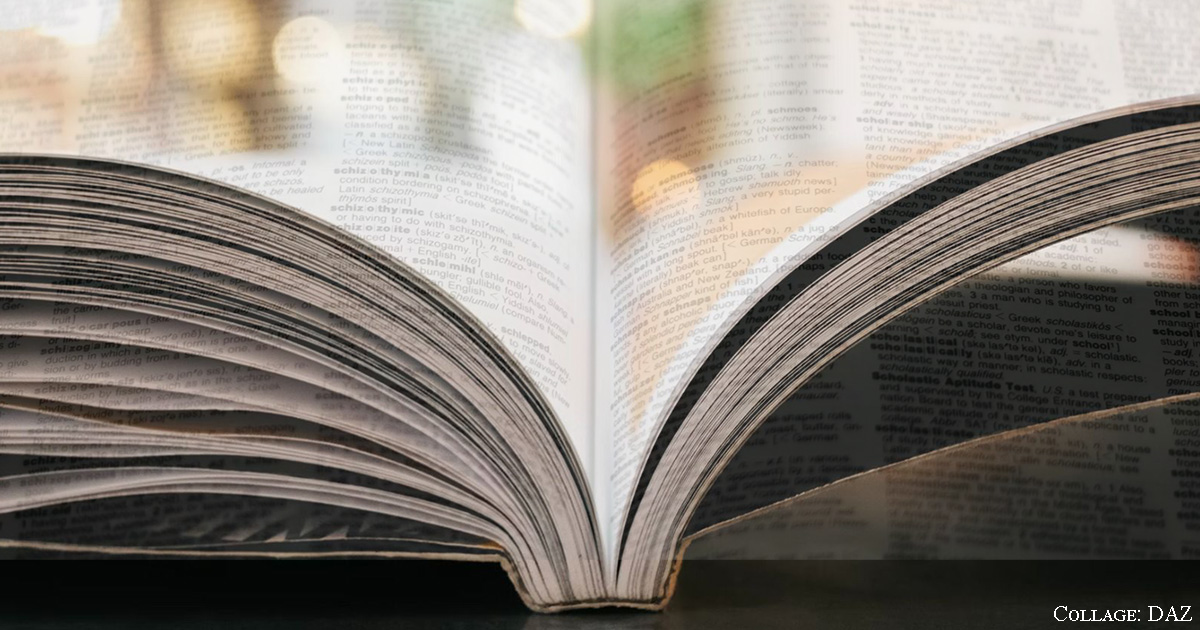Im Jahr 2017 wurde in Kasachstan ein wegweisendes Dekret verabschiedet: Bis 2025 sollte die Staatssprache endgültig von der kyrillischen auf die lateinische Schrift umgestellt werden. Dieses Projekt wurde sofort als strategischer Schritt präsentiert – nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell, politisch und sogar geopolitisch. Für die Befürworter der Reform symbolisierte die Latinisierung vor allem Modernisierung, Weltoffenheit und die Befreiung vom sowjetischen Erbe. Für die Kritiker hingegen bedeutete sie unnötige Kosten und eine wachsende Unsicherheit, die letztlich zu sozialen Spannungen führen könnte.
Nun ist das Jahr 2025 da und die Frage drängt sich auf: Hat Kasachstan sein Ziel erreicht? Die Antwort ist, wie so oft, nicht einfach.
Von den Ambitionen zur Realität
Die ersten Jahre nach dem Dekret von Präsident Nasarbajew waren von intensiver Arbeit geprägt. Es wurden Arbeitsgruppen gebildet, mehrere Varianten des Alphabets entwickelt und breit in der Gesellschaft diskutiert. Doch genau hier traten die ersten Schwierigkeiten auf. Jede Version wurde kritisiert: mal sei sie zu kompliziert zu schreiben, mal unbequem zu lesen, mal würden die phonetischen Besonderheiten der kasachischen Sprache nicht ausreichend berücksichtigt.
Erst 2021 gelang es, eine sogenannte „Endfassung“ des Alphabets abzustimmen. Diese wurde öffentlich als Grundlage für Schulbücher, amtliche Dokumente und künftige digitale Anwendungen vorgestellt. Damals schien es, als nähere sich die Sache ihrem logischen Abschluss und die kyrillische Schrift würde tatsächlich bis 2025 der Vergangenheit angehören.
Doch bereits ein Jahr später wurde klar: Der Zeitplan ist nicht einzuhalten. Präsident Kassym-Schomart Tokajew vertrat eine deutlich vorsichtigere Haltung. Er sagte offen, der „Übergang dürfe nicht mechanisch sein“ – es gehe nicht einfach um einen Wechsel der Zeichen, sondern um eine tiefgreifende Reform, die einen durchdachten Ansatz erfordere. Schließlich wurden die offiziellen Pläne angepasst: Der Übergang sollte nun von 2023 bis 2031 gestreckt werden.
Was wurde in der Praxis erreicht?
Heute, im Jahr 2025, sehen wir ein Zwischenergebnis. Die lateinische Schrift ist bereits in staatliche Strukturen und Medien vorgedrungen. Auf den Webseiten der Regierung, der Agentur „Kazinform“ und einiger Ministerien kann man die Sprache in lateinischer Schrift auswählen, viele Dokumente erscheinen in beiden Versionen. In den Schulprogrammen werden neue Lehrbücher erprobt, Lehrkräfte absolvieren Fortbildungen.
Einen massenhaften Übergang gibt es jedoch noch nicht. Die überwältigende Mehrheit der Bürger schreibt und liest weiterhin in kyrillischer Schrift. Selbst in sozialen Netzwerken begegnet man der Latinisierung nur selten – meist in experimentellen Beiträgen oder in der jungen IT- und Projekt-orientierten Szene.
Ein weiteres Indiz sind Schilder und Werbung. In Großstädten wie Almaty oder Astana finden sich vereinzelt lateinische Beschriftungen, doch das bleibt die Ausnahme. Die Unternehmen zögern, ihr Branding umzustellen: Es kostet Geld, und verbindliche Vorschriften gibt es bislang nicht.
Warum ist es so schwierig?
Zum einen geht es ums Geld. Nach Schätzungen von Experten werden allein für das Ersetzen der Lehrbücher, die Weiterbildung der Lehrer und die Anpassung der IT-Systeme über 600 Millionen US-Dollar benötigt. Für die kasachische Wirtschaft ist das ein durchaus spürbarer Betrag.
Zum anderen spielt die Gewohnheit eine Rolle. Für zwei Generationen von Kasachstanern ist die kyrillische Schrift die natürliche Umgebung, in der sie aufgewachsen und zur Schule gegangen sind. Der Wechsel in der Schreibweise wird als ein gewaltsamer Bruch mit der Vergangenheit empfunden. Besonders deutlich spüren dies ältere Menschen und russischsprachige Bürger.
Drittens hat die Debatte um die Varianten des Alphabets ein gewisses Misstrauen geweckt. Wenn sich innerhalb weniger Jahre die offizielle Version des kasachischen Alphabets mit lateinischen Buchstaben drei- oder viermal ändert, dann fragen sich die Menschen: Lohnt es sich überhaupt, etwas zu lernen, das vielleicht im nächsten Jahr schon wieder geändert wird?
Die Latinisierung ist jedoch mehr als nur eine Frage der Sprache. Sie ist ein Symbol. Für die einen steht sie für eine Modernisierung der Gesellschaft und die Annäherung an die globale Welt. Die lateinische Schrift wird wahrgenommen als „Alphabet des Internets“, „Alphabet der Technologie“, „Alphabet der Zukunft“. Für die anderen ist sie ein Zeichen der Abgrenzung von Russland und der sowjetischen Vergangenheit.
Kein Wunder, dass gerade die russischen Medien diesem Thema so viel Aufmerksamkeit widmen. Dort wird die Latinisierung häufig als ein Schritt Kasachstans in Richtung der Türkei oder des Westens dargestellt. Und obwohl die kasachischen Behörden betonen, dass es in erster Linie um nationale Identität gehe, ist der geopolitische Unterton stets präsent.
2025: Endpunkt oder Zwischenstopp?
2017 sprach man vom Jahr 2025 als dem endgültigen Zeitpunkt des Übergangs. Heute ist klar: Es ist erst die Mitte des Weges. In der Realität trat Kasachstan ins Jahr 2025 mit einem Alphabet ein, das zwar beschlossen, aber noch nicht flächendeckend eingeführt ist.
Es ist vergleichbar mit einem neu gebauten Haus, in das die Bewohner noch nicht eingezogen sind – sie leben weiterhin im alten. Die kyrillische Schrift wird noch lange mit der lateinischen koexistieren. Wahrscheinlich wird der Prozess erst gegen Ende des Jahrzehnts, etwa bis 2031, abgeschlossen sein.
Der Übergang zur lateinischen Schrift ist nicht nur eine Prüfung für Linguisten, sondern für das ganze Land. Er wird zeigen, wie sehr bereit Kasachstan ist für großangelegte Reformen, die Zeit, Mittel und Geduld erfordern.
Wird die lateinische Schrift in zehn Jahren alltägliche Norm sein? Wahrscheinlich ja. Doch zugleich wird die kyrillische Schrift noch lange als „zweite Schicht“ der Kultur bestehen bleiben. Vielleicht werden die Kasachen in ein oder zwei Generationen beide Alphabete gleichermaßen beherrschen – und genau darin könnte ihr besonderer Vorteil liegen: die Fähigkeit, sowohl Kyrillisch als auch Lateinisch zu lesen und damit Zugang zu einem weitaus breiteren kulturellen Erbe zu haben.
Das Jahr 2025 ist keine Endstation, sondern ein Etappenziel, an dem Kasachstan innegehalten hat, um den bisherigen Weg zu bewerten. Die lateinische Schrift ist zwar beschlossen, aber noch keine Norm. Die kyrillische Schrift lebt weiter und wird es noch lange tun. Der Übergang wird verschoben, aber nicht aufgehoben.
Und vielleicht ist das auch gut so. Denn jede kulturelle Reform braucht Zeit. Ein Alphabet – das sind nicht nur Zeichen auf Papier. Es ist ein Werkzeug des Denkens, des Gedächtnisses und der Identität. Es in acht Jahren zu verändern, ist unmöglich – doch in ein bis zwei Generationen durchaus realistisch.