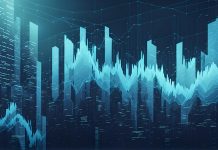Ein Interview mit Irina Unruh über die Fotografie, Kirgisistan und das Gefühl von Heimat.
Es ist bereits dunkel, als ich dem Videocall mit Irina beitrete. Vier Stunden Zeitverschiebung liegen zwischen ihrem lichtdurchfluteten Zimmer in Deutschland und meiner Unterkunft im kirgisischen Ort Rotfront. Dieses Dorf, das bis 1927 den Namen Bergtal trug, kennt Irina nur zu gut, denn unweit von hier ist sie aufgewachsen. Das ebenfalls kirgisische Dorf Tel’man, was man auch Grünfeld nannte, war bis zu ihrem neunten Lebensjahr Irinas Heimat.
Wenn sie in Kirgisistan auf Reisen ist, besuche sie immer auch Tel‘man und Rotfront, um dort alte Freundschaften zu pflegen und Verwandte zu besuchen. Obwohl der Bevölkerungsanteil der Russlanddeutschen in diesen Orten nach dem Ende der Sowjetunion stark zurückgegangen ist, lebt hier noch immer eine größere Anzahl deutschsprachiger Familien.
Schließlich wanderte auch Irinas Familie 1988 im Zuge der damaligen Aussiedelung der deutschen Minderheit von Kirgisistan nach Deutschland aus. Inzwischen lebt sie mit ihrer Familie im Münsterland, wo sie als Lehrerin und Fotografin tätig ist. Im April 2024 veröffentlichte sie einen Fotografie-Bildband unter dem Namen Where The Poplars Grow und hat mit uns darüber gesprochen.
Irina, wie bist du zur Fotografie gekommen?
Das ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat, also seit meiner Kindheit. Mein Vater hat als Jugendlicher selbst fotografiert und er hat die technischen Aspekte des Fotografierens, z. B. wie man Fotos entwickelt, wiederum meiner Tante beigebracht. Nachdem er selbst Vater geworden war, hatte er nur noch wenig Zeit für das Fotografieren, da die meisten Leute in den Dörfern in Kirgisistan Selbstversorger sind. Aber meine Tante hat dieses Hobby beibehalten und sie hat weiter fotografiert, auch nachdem sie selbst Mutter geworden war. Sie hat unseren Alltag fotografisch dokumentiert.
Das Fotografieren fand ich schon als Kind sehr spannend und ich wollte immer die Geschichten hinter den Bildern kennenlernen. Wer sind die abgebildeten Personen? Wo kommen sie her? Wer hat die Fotos gemacht? Außerdem habe ich mir viele Details auf den Bildern angeschaut: Was haben sie an, wo wohnen sie oder was sieht man im Hintergrund?
Wir hatten damals eben wenig Kinderbücher oder überhaupt wenig Bücher, so dass diese Bildergeschichten stets ein Eintauchen in vergangene Zeiten gewesen ist. Ich fand, dass die Fotografie mir die Welt geöffnet und Einblicke in andere Welten gegeben hat. Was ich außerdem mit der Fotografie verbinde, sind Freiheit und ein selbstbestimmtes Handeln.
Du warst früher Lehrerin und bist dann in Teilzeit gegangen, um mehr Zeit in die Fotografie investieren zu können. Gab es für dich ein initiales Ereignis, was diese Entscheidung angestoßen hat?
Ja, ein solches Ereignis war tatsächlich ein Stück weit die Geburt meines Sohnes. Ich lebe meiner Tochter bereits vor, dass sie alles machen kann. Bei meinem Sohn hatte ich das Gefühl, dass auch er es als selbstverständlich ansehen sollte, dass eine Frau und Mutter viele Möglichkeiten hat. Da hatte ich das Gefühl: Wenn ich es jetzt nicht probiere, dann bereue ich es vielleicht irgendwann. Beiden Kindern wollte ich vorleben, ihren Herzensthemen zu folgen, auch wenn dies eventuell zeitweise herausfordernd sein kann.
Ich bin inzwischen aber tatsächlich wieder zurück in die Lehramtstätigkeit gegangen, wieder in Teilzeit. Im Moment bin ich Klassenlehrerin einer vierten Klasse. Ich erlebe inzwischen, dass ich beides ziemlich gut kombinieren kann und dass die Schule sehr stark von der Fotografie und der visuellen Sprache profitiert. Ich habe angefangen, den Kindern einen Fokus auf die Schönheit unserer Welt zu vermitteln und mit ihnen den Blick für Details zu üben, das Licht zu sehen und zu beobachten, wie es sich verändert.
Dein Fotoband heißt Where The Poplars Grow (dt.: Wo die Pappeln wachsen). Im Text zur Ausstellung deiner Fotografien in Detmold heißt es: „Pappeln blühen in Deutschland und in Kirgisistan und irgendwo dazwischen erzählen sie vom Suchen und Finden von Heimat.“ Kannst du in Worte fassen, was Heimat für dich bedeutet?
Man sagt, dass Heimat dort ist, wo man sich wohlfühlt, oder dass Heimat dort ist, wo das Herz ist. Ich habe allerdings mit der Zeit gemerkt, dass Heimat auch ortsgebunden ist. Der Ort, wo wir zur Welt kommen, ist einfach ein besonderer Ort. Als ich anfing, mich wieder mit meiner Herkunft und meiner Geburtsregion zu beschäftigen, habe ich das gemerkt.
Ich lebe schon seit vielen Jahren nicht mehr dort und dennoch ist da so eine tiefe Verbindung zu diesem Ort. Ich glaube, dass man unterbewusst Dinge wahrnimmt in den ersten Lebensjahren, wie zum Beispiel das Licht, Geräusche oder Gerüche sowie natürlich auch die menschlichen Verbindungen. Man nimmt viele Dinge wahr, die einem wichtig sind, und wenn man sie lange nicht gesehen, nicht gerochen und gehört hat, merkt man plötzlich: Das alles ist auch ein Teil meiner Heimat.
Für mich waren es die Pappeln, denn ich bin umgeben von Pappeln aufgewachsen. Das ist für mich eine besondere Baumart. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in Deutschland Pappeln sehe. Hier wachsen sie zum Glück auch.
Wie identifizierst du dich und welche Rolle spielen dabei Nationalitäten?
Ich tue mich sehr schwer damit, mich mit einer Nationalität zu identifizieren. Ich
sage sehr ungern: „Ich bin Deutsche.“ Ich sage aber auch so gut wie nie: „Ich bin Russlanddeutsche.“ Aber klar, per Definition bin ich es.
Ich sehe mich als Humanistin und denke, dass wir alle Menschen sind und dass uns so vieles verbindet. Viel wichtiger ist mir dieser Begriff von Heimat, also eine regionale Zuordnung. Wo komme ich her? Wo bin ich aufgewachsen oder wo lebe ich derzeit? Welche Bräuche und Traditionen kenne ich? Welche kollektiven Erfahrungen habe ich gemacht? Das hilft, um sich gegenseitig besser zu verstehen. Gleichzeitig verabscheue ich es, wenn die Nationalität als Mittel der Ausgrenzung und Diskriminierung genutzt wird, wie das beispielsweise in der Vergangenheit geschah, in der insbesondere Minderheiten in der ehemaligen Sowjetunion und anderen Teilen der Welt Ausgrenzungen und Diskriminierungen erfuhren. Auch heute ist dies leider weltweit ein enormes Problem.
Mir persönlich ist auf jeden Fall bewusst, dass ich derzeit in einer sehr privilegierten Situation bin mit meiner Nationalität, hier in Deutschland, in Europa lebend und mit all den Möglichkeiten, die sich dadurch für mich ergeben. Das ist ein Gegensatz zu Personen, die woanders zur Welt gekommen sind und deren Pass eine andere Farbe hat. Das ist die Realität, in der wir leben, und die ist ziemlich bitter in meinen Augen.
Welche Erlebnisse haben dich in deiner Kindheit am meisten geprägt?
Es gab einige Erfahrungen der Fremdzuschreibung, die viele sogenannte Russlanddeutsche gemacht haben. In einer äußerst irritierenden Situation, da war ich im ersten Schuljahr im heutigen Kirgisistan, da hat mich ein Kind als Faschistin bezeichnet. Ich merkte mir diesen Begriff und fragte später meine Mutter, was das für ein Wort sei.
Meine Mutter guckte mich mit großen Augen an, war völlig aufgelöst und fing an zu weinen. Da habe ich gemerkt: Oh, das ist, glaube ich, nichts Gutes. Meine Mutter erklärte mir diesen Begriff auf kindgerechte Art. Da habe ich auch gemerkt, dass man ausgegrenzt werden kann. Du gehörst nicht zu uns, du bist anders. Das gibt es im Grunde genommen überall. Gleichzeitig sprachen meine Mutter und ich darüber, dass wir alle Kinder seien.
Trotz dieser einprägsamen Erfahrung wurde ich stärker durch die alltäglichen Aspekte des interkulturellen Zusammenlebens geprägt wie die Mehrsprachigkeit sowie die kulturelle und religiöse Vielfalt unter den Menschen unseres Dorfes. Als Kind empfand ich es beispielsweise als völlig selbstverständlich, dass die Familiensprache anders sein kann als die Sprache des Unterrichts in der Schule. Es fand bereits unter uns Kindern ein permanenter Wechsel zwischen den im Dorf gesprochenen Sprachen statt.
Wie ist dein Bildband entstanden?
Das war ein Prozess und keine Entscheidung von heute auf morgen. Ich habe eine tolle Mentorin: Sarah Leen, ehemalige Direktorin für Fotografie beim National Geographic Magazin. Bei ihr habe ich einen Workshop gemacht und sollte eine Fotostrecke mitbringen. Da hatte ich allerdings nichts Aktuelles und keine Fotostrecke, die sie nicht schon kannte. Also habe ich eine große Auswahl von Bildern aus Kirgisistan mitgebracht. Sarah hat mich ermutigt, daraus einen Bildband zu machen.
Je intensiver die Verlegerin und ich uns später mit meinen Bildern aus Kirgisistan auseinandersetzten, desto klarer wurde, dass ich in erster Linie meine Geschichte erzählen kann mit meinem Bezug zu diesem Land und warum mir dieses Land so wichtig ist. Also erzähle ich meine Familiengeschichte.
In einem Podcast-Interview mit Steppenkinder hast du gesagt: „Wir werden in eine bestehende Geschichte hineingeboren.“ Wie wichtig ist es, die eigene Vergangenheit und auch die Familienvergangenheit zu kennen und wie wichtig war es für dich, das zu ergründen?
Sehr wichtig. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir als ein leeres, unbeschriebenes Blatt Papier zur Welt kommen. Wir Menschen sind Geschichtenerzähler und wir lieben Geschichten. Je mehr man über die Familiengeschichte weiß, desto besser kann man sich selbst verstehen. Außerdem glaube ich, dass es uns menschlicher macht, wenn wir uns gegenseitig verstehen und wenn wir unsere Eltern verstehen können, also die Generation vor uns.
Wir sind alle miteinander verwoben, ein ganzes Netzwerk an Geschichten. Ich glaube, dass sich jeder Mensch irgendwann auf der Suche nach der eigenen Identität die Fragen stellt: Wohin bin ich hineingeboren und was war damals gerade historisch los?
Was versuchst du, deinen beiden Kindern im Zusammenhang mit Selbstfindung und Identität mitzugeben?
Ich gebe ihnen den Gedanken mit, dass wir alle in eine komplexe Geschichte hineingeboren werden und dass jeder Mensch eine Geschichte hat. Damit geht einher, dass wir nicht vorschnell über Menschen urteilen und verständnisvoller miteinander umgehen sollten. Wir kennen die Geschichten der anderen nicht immer, weshalb wir Toleranz üben und uns gegenseitig mit Verständnis begegnen sollten, denn uns verbindet oft so unglaublich viel.
Spielt dein Migrationshintergrund noch eine größere Rolle für deine Kinder?
Ja, interessanterweise schon. Meine Tochter hat sehr früh angefangen, ein großes Interesse für Kirgisistan zu zeigen. Da war sie noch ein Kleinkind. Ich habe ihr viele Bilder von meinen Reisen dorthin gezeigt. Das fand sie spannend und sie hat sich alles auf den Bildern sehr genau angeschaut.
Einmal durfte ich in Tel‘man an der Schule fotografieren, in der ich selbst Schülerin war. Als ich meiner Tochter die Bilder gezeigt habe, ist ihr aufgefallen, dass ich ein Mädchen scheinbar besonders oft fotografiert habe. Mir selbst ist das gar nicht aufgefallen. Sie fragte mich dann nach dem Namen des Mädchens. Ich stand da und dachte: Ach du Schreck, das weiß ich gar nicht. Dann guckte sie mich an und sagte: „Wie, du weißt es nicht? Das nächste Mal, wenn du hinfährst, musst du sie bitte fragen. Und ich würde gerne noch wissen, was sie so mag und was sie gern macht.“
Also bin ich tatsächlich ein Jahr später noch mal zurück mit einem Stapel Fotos und habe in Tel‘man nach dem Mädchen gesucht. Assel heißt sie, das weiß ich inzwischen, und sie ist nur zwei Monate älter als meine Tochter. Ich habe mich mit Assels Familie angefreundet und einige Jahre später habe ich sie auch gemeinsam mit meiner Tochter besucht. Die beiden waren sofort so innig miteinander. Das war eine sehr schöne Erfahrung.
Durch das Zeigen der Bilder, kam ihr das Land außerdem so vertraut vor. In unser Reisetagebuch hat sie geschrieben: „Ich freue mich sehr auf diese Reise. Endlich das Land kennenzulernen, was auch ein Teil von mir ist.“ Damals war sie zwölf und sie hat gesehen, dass Kirgisistan auch ein Teil ihrer Identität ist. MG/DAZ
Den Bildband Where The Poplars Grow kann man online direkt beim Verlag Shiftbooks bestellen. Zudem ist das Buch über jede lokale Buchhandlung sowie über Thalia und Amazon erhältlich.
Außerdem hat Irina auch an anderen, spannenden Projekten gearbeitet. So hat sie beispielsweise im vergangenen September eine Fotostrecke für die UN in Kirgisistan umgesetzt, wo es mit Recipes for Change um die Themen Nachhaltigkeit, Zero Waste und Zero Kilometer bei der Ernährung ging. Mehr Infos zu Irinas Arbeit gibt es auf ihrer Website www.irinaunruh.com sowie bei Instagram unter @irinaunruh.