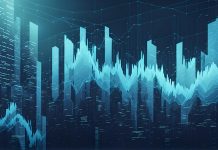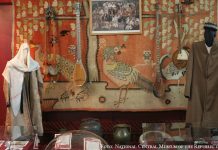Elsa Schleiger wohnt im Dorf Roschdestwenka, das heute Kabanbai Batyr heißt. Sie wurde 1953 geboren und hat ihr ganzes Leben hier verbracht. Sie erzählt von der deutschen Gemeinde im Dorf zu Sowjetzeiten, vom Niedergang nach der Abreise der Deutschen, von den heutigen Veränderungen im Alltag und von ihrer eigenen Identität.
Die Siedlung wurde bereits 1895 gegründet und hieß einst – vor ihrer Umbenennung in „Roschdestwenka“ – Friedensfeld.
Frau Schleiger, erzählen Sie uns bitte, wie sich das Dorf in Ihrem Leben hier verändert hat?
Nach dem Wegzug der Deutschen in den 90er Jahren hat sich im Dorf alles schlagartig verändert. Früher hat bei uns alles funktioniert: riesige Gewächshäuser mit Gurken, Tomaten, Rosen im Winter, es wurden Hybridtrauben angebaut. Die Viehzucht war stark, unser Staatsbetrieb war im gesamten Bezirk Zelinograd bekannt. Es gab eine Schweinefarm, sehr große Anbauflächen – Mais, Weizen, Gemüseanbau. Aber dann begann der Niedergang: Die Schweinefarm und der Gemüseanbau verschwanden, der Staatsbetrieb brach praktisch zusammen. Ich habe dort 47 Jahre lang gearbeitet und bin danach in Rente gegangen.
Es gibt ein Buch auf Deutsch über unser Roschdestwenka – über die Bewohner, ihre Geschichte und über unseren Betrieb.
Was ist heute von dem Betrieb übriggeblieben?
Es hat sich jemand gefunden, der einen Teil der Produktionsanlagen aufgekauft und wieder aufgebaut hat. Jetzt gibt es noch Viehzucht – allerdings keine Milchviehhaltung, sondern Mastviehhaltung. Aber vom Staatsbetrieb ist insgesamt nur sehr wenig übriggeblieben. Die Menschen ziehen weg, um in der Stadt zu arbeiten.
Ändert sich derzeit etwas in der Infrastruktur des täglichen Lebens?
Es wurde eine zentrale Wasserversorgung verlegt. Vor einigen Tagen fuhren Busse auf dem Staatsbetrieb ein – das ist eine große Freude für uns. Ich habe bemerkt, dass man damit begonnen hat, Löcher für die Masten der Straßenbeleuchtung zu bohren.
Ich würde mir sehr wünschen, dass der Dorfvorsteher aus den Reihen der Einheimischen gewählt wird. Zu Sowjetzeiten hatten wir einen starken Vorsitzenden des Dorfrats, Herbert Polynskij – man fürchtete ihn nicht, aber man respektierte ihn: Im Mai gab es keine Misthaufen, keine Asche, die Häuser waren weiß getüncht, alles war in perfekter Ordnung. Jetzt ist das Dorf leider ungepflegt.
Lebten hier zu Sowjetzeiten hauptsächlich Deutsche?
Zu Sowjetzeiten und davor war das Dorf hauptsächlich von Deutschen bewohnt, es gab nur sehr wenige kasachische Familien, höchstens drei oder vier. Nicht weit von uns befand sich eine Zweigstelle unseres Staatsbetriebs „Oktjabr“ – dort lebten viel mehr Kasachen.
Meine Familie gehörte zu den Repressierten, wie man das jetzt nennt, meine Mutter und mein Vater kamen beide von der Wolga. Meine Mutter kam noch als junge Frau in die Arbeitsarmee und musste dort viele Jahre bleiben.
Erzählen Sie uns bitte, was Sie über die früheren Bewohner von Roschdestwenka wissen.
Wir Deutschen lebten hier alle sehr harmonisch zusammen. Ich kannte alle im Dorf – wer wo wohnte. Ich persönlich erinnere mich noch an den Vorsitzenden der Kolchose namens Wilhelm. Er war ein sehr strenger Chef. Er hatte viel durchgemacht, ihm fehlte ein Bein – ich weiß allerdings nicht, wo er es verloren hatte. Er ist auch hier begraben. Ich erinnere mich an den Verwalter Erwin Will, ebenfalls ein sehr guter Mensch. Alexander Magel war unser Zootechniker. Der Direktor unseres Staatsbetriebs „Oktjabr“ war Grigorij Agafonow, über ihn sagte man: „Der Vater kommt“. Er war streng, aber gerecht. Auch er ist auf diesem Boden begraben.
Welche Spuren der deutschen Präsenz sind heute noch sichtbar? Irgendwelche Häuser, Schulen?
Ja, die Schulen sind geblieben. Sie sind sehr gepflegt, es war immer schön, sie zu besuchen, sie sind sauber und ordentlich. Das verdanken wir natürlich den Schulleitern. Das Kulturhaus wurde renoviert und ist bis heute in Betrieb: Dort finden jetzt vor allem Tanzveranstaltungen, Nordic-Walking-Kurse und Konzerte statt. Ich selbst gehe gerne dorthin. Momentan habe ich allerdings viel Arbeit im Haus und im Garten und komme nicht dazu.
Das Einzige, was mich stört, ist, dass gegenüber unserem Club das Gebäude der ehemaligen Staatsgutsverwaltung verfällt. Es bricht praktisch auseinander. Und wie schön und gepflegt war es früher, in dieser wunderschönen grünen Umgebung!
Es gibt noch einen alten Friedhof. Doch dort kümmert sich fast niemand um die Gräber. Manchmal schicken Verwandte der auf dem Friedhof Begrabenen Geld aus Deutschland und stellen Leute ein – aber das sind Einzelfälle. Es gibt sehr viele verlassene Gräber, was sehr traurig ist.
Sind im Dorf noch deutsche Traditionen erhalten geblieben, die bis heute gepflegt werden? Feiern Sie vielleicht noch etwas gemeinsam mit Ihren Dorfbewohnern?
Ehrlich gesagt, nein. Ich persönlich pflege noch bestimmte Traditionen. Früher haben wir jeden Freitag gebacken. Bis heute backe ich freitags Strudel, Brot, Kuchen mit süßen Streuseln und Brezeln. Heute wollen das viele nicht mehr machen. Manche wissen auch nicht, wie. Viele meiner Bekannten bitten mich, für sie zu backen.
Ich liebe unsere Traditionen – vielleicht habe ich mich einfach daran gewöhnt. Vielleicht hat meine Mutter mir das vermittelt. Samstags wird bei uns zu Hause gewaschen und geputzt. Sonntags sollte man eigentlich frei haben. Aber unsere Mutter hat ihr ganzes Leben lang sonntags gewaschen, weil sie samstags als Köchin im Kindergarten gearbeitet hat. Sie hatte nur einen freien Tag – den Sonntag. Am Sonntag wusch sie dann. Dabei sagte sie: „Möge Gott mir vergeben, ich habe keine andere Zeit dafür.“
Wie viele deutsche Familien gibt es heute noch?
Sehr wenige. Es gibt einige, die in Mischehen leben. Ich selbst lebe allein. Da ist noch Nelja Jurijewa – eine Deutsche mit einem russischen Ehemann. Mein Cousin Walerij Polynskij hat eine russische Frau. Meine Cousine lebt auch hier – sie ist Deutsche und hat Kinder. Die anderen hier sind hauptsächlich Kasachen und Russen.
Kommen noch Leute, die nach Deutschland gezogen sind, hierher?
Viele Deutsche, die weggezogen sind, kommen immer noch her, denn sie vermissen es. Unter ihnen sind auch einige in meinem Alter, die mich kennen und sich daran erinnern, mit wem wir gemeinsam gearbeitet haben. Auch ihre Kinder kommen manchmal mit.
Früher kamen sie öfter, jetzt seltener. Sie haben Nostalgie für vieles. Der Umzug (die Umsiedlung nach Deutschland – Anm. d. Red.) war schwer für sie, viele haben geweint, manche wollten zurück nach Kasachstan. Mit der Zeit haben sie sich daran gewöhnt, aber einige bereuen es: Sie haben ihre Häuser hier für einen Spottpreis verkauft, und dort war eine neue Wohnung teuer. Aber sie können nicht mehr zurückkehren, denn ihre Kinder sind in einem anderen Leben aufgewachsen.
Mein Bruder ist weggezogen, aber wenn er zu Besuch nach Kasachstan kommt, sagt er: „Ich bin nach Hause gekommen.“ Seine Freunde sind alle Kasachen, und wenn er aus Deutschland anruft, fragt er immer: „Wie geht es Kairat, wie geht es Shumatai, wie geht es Amangeldy?“ Das sind alles meine Nachbarn und seine Freunde.
Erzählen Sie uns doch bitte, wie Sie Ihre Identität heute definieren.
Ich betrachte mich als Deutsche, die in Kasachstan geboren wurde – das ist mein Heimatland. Die Kasachen sind meine Freunde, meine Nachbarn. Sie würden mich niemals gehen lassen, ohne mich vorher an ihren Tisch einzuladen und zu bewirten. Ich verstehe ihre Traditionen. Ich liebe die Kasachen sehr. Es gibt keine schlechten Nationen, es gibt nur schlechte Menschen.
Sprechen Sie noch Deutsch?
Ich kann es. Vor vier Jahren kam eine Journalistin zu uns, ich habe mich mit ihr auf Deutsch unterhalten. Als ich in Deutschland war, sagten mir die dortigen Deutschen, dass ich sehr genau und richtig spreche und dass die heutige Aussprache bei ihnen nicht richtig sei. Ihnen zufolge spreche ich so, wie die Deutschen früher gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber tatsächlich hatte jedes Dorf seinen eigenen Dialekt.
Was ist der wichtigste Rat, den Sie jungen Menschen, insbesondere kasachischen Deutschen, mit auf den Weg geben würden?
Dass sie ihre Heimat nicht verlassen sollen. Dass sie in dem Land bleiben sollen, in dem sie geboren wurden. Das ist heilig. Unsere Mutter hat ihr ganzes Leben lang gesagt: „Wo du geboren bist, da gehörst du hin.“ Und sie wollte nicht nach Deutschland gehen. Ich bin zu Hause und werde nirgendwo mehr hingehen.