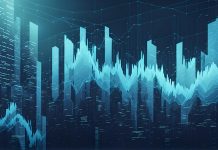Zentralasien rückt zunehmend in den Blick der deutschen Politik. Dennoch spiegelt sich das nur teilweise an deutschen Universitäten wider. Ein genauerer Blick zeigt: Ansätze sind da, doch das Geld könnte fehlen.
In den Regionalstudien der deutschen Universitäten wird Zentralasien als postsowjetischer Raum meist den Osteuropastudien angehangen. Das wird dieser Region nicht gerecht, ist geografisch falsch und reduziert sie auf ihre sowjetische Vergangenheit. Der Osteuropabegriff wird dabei in vielerlei Hinsicht kritisiert.
Dass sich bei der Einordnung wenig geändert hat, hat auch strukturelle Gründe. Meist deckten Einrichtungen, die zu Ost- und Südosteuropa forschten, am Rand auch Zentralasien ab und führen dies bis heute fort. Ihnen sind Veröffentlichungen und Kooperationen zu verdanken, die es sonst vielleicht nicht gäbe. Denn die Zentralasienstudien leiden besonders am Abbau der ohnehin zu wenigen Lehrstühle und am Rückgang an Publikationen.
Auch das Lehrprogramm zentralasiatischer Sprachen lässt zu wünschen übrig. So zählt die Humboldtuniversität in Berlin mit Usbekisch und Tadschikisch zu den Exoten. Sie schuf erfreulicherweise auch den Master „Zentralasienstudien“, welcher mittlerweile auf der Website nur noch unter „Geschlossene Studiengänge – Archiv“ gelistet wird. Es ist zu vermuten, dass er dem Studiengang Asien-/Afrikastudien angegliedert wurde. Das ist zwar zu bedauern, aber geografisch korrekt.
Außerdem könnte eine solche Einordung es ermöglichen, eine objektivere Perspektive auf die zentralasiatischen Länder zu vermitteln als unter dem früher üblichen Begriff „Osteuropa“. Vielleicht gelingt es dadurch auch, mehr Interessierte zu gewinnen, die durch das Studium langsam herangeführt werden, ohne sich von Anfang an auf die Region spezialisieren zu müssen.
Neue Ansätze, aber weniger Geld
Ein langsames Kennenlernen bot auch das Go-East-Programm des Deutschen Akademischen Austauschbundes (DAAD). Das Programm unterstützte durch Stipendien Teilnehmende von Sommer- und Winterschulen in Osteuropa, dem Südkaukasus und Zentralasien. Regelmäßig wurden darüber beispielsweise mehrwöchige Programme in Tadschikistan zu Sprache, Kultur und Land angeboten. Die Winter- und Sommerschulen konnten dabei ganz verschiedene Themenbereiche abdecken.
Auf Grund fehlender Finanzierung durch den Bund musste der DAAD 13 seiner Programme aussetzen, zu denen auch das Go-East-Programm zählt. Auch das generelle Stipendienprogramm für Auslandaufenthalte außerhalb der EU hat darunter gelitten. Der DAAD war bisher eine gute Möglichkeit, Praktika und Studiensemester in Zentralasien zu finanzieren. Die Stipendienraten wurden jedoch so gekürzt, dass sie weniger Studierende unterstützen und oft nicht den ganzen Zeitraum abdecken können.
Nichtsdestotrotz sind auch positive Entwicklungen zu vermerken. So wurde 2023 ein Deutsch-Kasachisches Institut für nachhaltiges Ingenieurwesen im kasachischen Aktau eröffnet, was in Kooperation verschiedener regionaler und deutscher Universitäten geschah. Dort sollen neue Studiengänge geschaffen werden.
Ein Positionspapier aus dem Jahr 2023, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegeben wurde, gibt außerdem Empfehlungen für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Zentralasien im Bereich Bildung, Forschung und Wissenschaft. Erstellt wurde dieses von Expert:innen und Professor:innen verschiedener Institute, die langjährige Erfahrung mit der Region haben.
Das Papier sah unter anderem die Förderung zentralasiatischer Sprachen an deutschen Universitäten, den Ausbau akademischer Mobilität, den Aufbau gemeinsamer Projekte und Forschungseinrichtungen vor. Ein Bedarf für Veränderung wird durch die deutschen Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen durchaus gesehen. Inwieweit diese Empfehlungen jedoch umgesetzt werden, hängt insbesondere von der Bereitschaft des deutschen Staates ab, solche Programme mitzufinanzieren.