Die intellektuelle Agenda Kasachstans hat im Oktober einen klaren Schwerpunkt erhalten: Auf dem Forum Digital Bridge 2025 in Astana trafen sich führende internationale Expertinnen und Experten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und digitale Technologien. Der Gründer des Instant-Messaging-Dienstes „Telegram“ Pawel Durow machte bei seinem Auftritt mehrere aufsehenerregende Ankündigungen – unter anderem die Eröffnung eines spezialisierten KI-Labors im Gebäude von Alem.ai sowie eine Kooperation mit dem nationalen Supercomputer-Cluster. Diese Entwicklungen werfen wichtige Fragen auf: Wie verändert die Entstehung einer starken digitalen Infrastruktur das Land? Welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus? Und was kann Kasachstan dabei von europäischen Partnern, insbesondere von Deutschland, lernen?
Das vom 2. bis 4. Oktober in Astana veranstaltete Forum Digital Bridge 2025 gilt als die größte Technologiekonferenz der Region. Konferenzen, Ausstellungen, Pitch-Sessions und ein umfangreiches Business-Programm brachten Expertinnen und Experten aus Dutzenden Ländern zusammen. Unter den Teilnehmern befanden sich prominente Namen: Telegram-Gründer Pawel Durow, KI-Investor Kai-Fu Lee sowie Fachleute von Stanford und Google. Damit rückt Astana definitiv auf die Karte des globalen Technologiedialogs.
KI für das Gemeinwohl
In seiner Rede kündigte Durow den Start eines spezialisierten KI-Labors bei Alem.ai und das erste Kooperationsprojekt zwischen Telegram und dem kasachischen Supercomputer-Cluster an, der vom Ministerium für Künstliche Intelligenz betrieben wird. Die Nutzung lokaler Supercomputing-Kapazitäten, so Durow, solle es ermöglichen, KI-Funktionen für eine große Zahl von Menschen „vertraulich, transparent und effizient“ bereitzustellen – und das sogar „für Milliarden von Nutzern“, wie es in offiziellen Mitteilungen hieß.
 In seiner Rede auf dem Forum gab sich Durow ausgesprochen locker und er lockerte auch das Publikum mit einem kleinen Scherz auf, wodurch er einen lebendigen Einstieg in das recht komplizierte Thema schuf. Aber, als sich Durow am Rande des Forums mit Präsident Kassym-Schomart Tokajew traf, war er absolut ernsthaft und konzentriert, um mit dem Staatsoberhaupt künftige Projekte im Bereich KI und Digitalisierung zu besprechen. Der Präsident betonte dabei ausdrücklich, dass KI ausschließlich friedlichen Zwecken dienen und dem Gemeinwohl verpflichtet sein müsse.
In seiner Rede auf dem Forum gab sich Durow ausgesprochen locker und er lockerte auch das Publikum mit einem kleinen Scherz auf, wodurch er einen lebendigen Einstieg in das recht komplizierte Thema schuf. Aber, als sich Durow am Rande des Forums mit Präsident Kassym-Schomart Tokajew traf, war er absolut ernsthaft und konzentriert, um mit dem Staatsoberhaupt künftige Projekte im Bereich KI und Digitalisierung zu besprechen. Der Präsident betonte dabei ausdrücklich, dass KI ausschließlich friedlichen Zwecken dienen und dem Gemeinwohl verpflichtet sein müsse.
Alem.ai wird als internationales Zentrum für Künstliche Intelligenz positioniert – als ein Ort für Forschung, Ausbildung und kommerzielle Entwicklung. Genau dort soll auch das neue Telegram-Labor entstehen. Parallel dazu hat Kasachstan im vergangenen Jahr massiv in den Aufbau seiner Supercomputer-Infrastruktur investiert: Im Juli 2025 wurde der leistungsstärkste Supercomputer Zentralasiens vorgestellt. Auf dem Forum wurden zudem Pläne für einen zweiten Cluster und den Ausbau eines nationalen Rechennetzwerks für Forschungs- und Anwendungszwecke bekanntgegeben. Für Forschungsgruppen und Start-ups bedeutet das einen grundlegenden Wandel ihrer technischen Möglichkeiten.
Vom technischen Standpunkt aus betrachtet, ist diese Entwicklung der IT-Infrastruktur entscheidend für die Erfolgschancen der anderen Vorhaben, denn moderne große KI-Modelle benötigen nicht nur ausgefeilte Algorithmen, sondern auch enorme Rechenkapazitäten, schnelle Datenspeicherung und optimierte Trainings- und Ausführungsumgebungen. Eine lokal ausgebaute Infrastruktur verringert die Abhängigkeit von ausländischen Datenzentren, reduziert Verzögerungen und ermöglicht die Anpassung von Modellen an die sprachlichen und kulturellen Besonderheiten der Region.
Greifbare Vorteile für Kasachstan
Die Entstehung internationaler Labore und nationaler Supercomputer bringt greifbare Vorteile. Globale Akteure ziehen Investoren an, schaffen neue Arbeitsplätze und fördern Pilotprojekte. Veranstaltungen wie das Forum Digital Bridge 2025 beschleunigen diese Kooperationen. KI-Modelle, die auf den kasachstanischen Sprach- und Kulturraum zugeschnitten sind, werden realistischer, was wiederum ein Gewinn ist für die Bildung, die Medizin, die Landwirtschaft und die Verwaltung hierzulande. Reale Projekte und eine moderne Forschungsinfrastruktur motivieren Studierende und Wissenschaftler, im Land zu bleiben oder aus dem Ausland zurückzukehren.
 Neben den Chancen ergeben sich jedoch auch ernsthafte Herausforderungen. Wenn große Plattformen die jeweiligen Nutzerdaten verarbeiten, müssen – insbesondere in Verbindung mit staatlichen Systemen – ausreichend Transparenz und Kontrolle gewährleistet sein. Vertrauen entsteht nicht nur durch eine entsprechende Technik, sondern auch durch klare Gesetze. Die wachsende Zahl von Rechenressourcen mit so großer Tragweite erfordert strenge Schutzmaßnahmen gegen Angriffe und Missbrauch. Ohne gezielte Bildungsprogramme besteht zudem die Gefahr, dass Kasachstan Technologien lediglich konsumiert, statt sie selbst zu entwickeln.
Neben den Chancen ergeben sich jedoch auch ernsthafte Herausforderungen. Wenn große Plattformen die jeweiligen Nutzerdaten verarbeiten, müssen – insbesondere in Verbindung mit staatlichen Systemen – ausreichend Transparenz und Kontrolle gewährleistet sein. Vertrauen entsteht nicht nur durch eine entsprechende Technik, sondern auch durch klare Gesetze. Die wachsende Zahl von Rechenressourcen mit so großer Tragweite erfordert strenge Schutzmaßnahmen gegen Angriffe und Missbrauch. Ohne gezielte Bildungsprogramme besteht zudem die Gefahr, dass Kasachstan Technologien lediglich konsumiert, statt sie selbst zu entwickeln.
Deutschland bietet hier ein wertvolles Vorbild: Das Land verfügt über eine nationale KI-Strategie, eine starke wissenschaftliche Basis und ein enges Netzwerk von Supercomputing-Zentren – darunter das Gauss Centre for Supercomputing und der neue Exascale-Rechner JUPITER in Jülich. Die deutsche Politik verbindet Forschungsförderung und industrielle Anwendung mit einem klaren Fokus auf Ethik, Datenschutz und rechtliche Verlässlichkeit.
Für Kasachstan ist das ein Beispiel, wie man ambitionierte Infrastrukturprojekte mit stabilen Bildungs- und Rechtsstrukturen in Einklang bringt. Europäische Supercomputer-Zentren bieten darüber hinaus nicht nur Hardware, sondern auch bewährte Organisationsformen: Kooperationen mit Universitäten, offene Wettbewerbsverfahren für Rechenzeit, Weiterbildungsprogramme und internationale Forschungsförderung. Kasachstan könnte also nicht nur von der Technologie, sondern auch von diesen institutionellen Erfahrungen profitieren.
Es braucht konkrete Maßnahmen
Damit große Initiativen nicht zu reinen Imageprojekten werden, braucht es konkrete Maßnahmen. Breite Bildungsprogramme an der Schnittstelle von IT, Mathematik und Anwendungsbereichen wie Medizin, Landwirtschaft oder Bauwesen sind entscheidend. Kooperationen mit europäischen Universitäten, etwa durch Austausch- und Doppelstudiengänge, sollten gefördert werden.
Ebenso wichtig sind Datenschutz- und KI-Gesetze, die weitere Innovationen ermöglichen und zugleich die Rechte der Bürger schützen. Öffentliche Register über den Einsatz von KI in Behörden könnten zusätzlich Vertrauen schaffen. Eine wettbewerbsbasierte Zuteilung von Rechenressourcen an Start-ups und Hochschulen, ergänzt durch Bildungsquoten, sowie gemeinsame Forschungsprojekte und Stipendienprogramme mit europäischen Partnern wären weitere Schritte in Richtung Nachhaltigkeit.
Die Ankündigungen von Pawel Durow und die auf dem Forum präsentierten Großprojekte sind mehr als PR: Sie markieren einen möglichen Wendepunkt für die technologische Landschaft Zentralasiens. Mit Alem.ai, den nationalen Supercomputern und einer wachsenden internationalen Aufmerksamkeit bestehen bereits gute Voraussetzungen für einen neuen, qualitativen Sprung.
Doch um diese Infrastruktur in einen nachhaltigen nationalen Vorteil zu verwandeln, braucht es mehr als nur Hardware – nämlich Bildung, Regulierung, offene Zugänge und eine klare Strategie für den privaten Sektor. In diesem Zusammenhang könnte der deutsche und europäische Erfahrungsschatz ein wertvolles Lehrbuch sein – nicht zum Kopieren, sondern zur klugen Anpassung an die einheimischen Gegebenheiten.




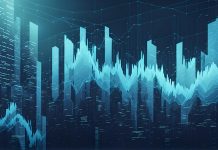





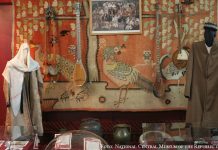














Great article, thank you for sharing these insights! I’ve tested many methods for building backlinks, and what really worked for me was using AI-powered automation. With us, we can scale link building in a safe and efficient way. It’s amazing to see how much time this saves compared to manual outreach.