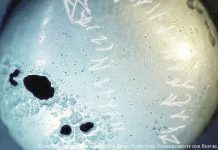Zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs spricht der Historiker und wissenschaftliche Mitarbeiter des Bayerischen Kulturzentrums der Deutschen aus Russland (BKDR) Dr. Viktor Krieger über seine Dienstreise nach Kasachstan, die Geschichte der Russlanddeutschen und die Bedeutung historischer Erinnerung. In eindrücklichen Worten schildert er, wie lang verdrängte Dokumente neue Einblicke in das Schicksal der deutschen Minderheit in der Sowjetunion geben – und warum persönliches Erinnern der Schlüssel für eine gemeinsame Zukunft ist.
Herr Dr. Krieger, was ist der Anlass für Ihre Dienstreise nach Kasachstan?
 Der Anlass ergab sich aus dem Umstand, dass das akademische Institut für Geschichte und Ethnologie, die in Kasachstan führende Institution auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaft, ihr 80. Gründungstag feierte. Mich verbindet viel mit dieser Forschungseinrichtung, weil ich hier Doktorand war und 1992 über die Geschichte der deutschen Siedler in Kasachstan vor 1917 promovierte. Ich danke den kasachischen Kollegen, dass sie mich zu der Jubiläumskonferenz anlässlich der Gründung des Instituts eingeladen haben. Gleichzeitig verbinde ich meine Reise mit einigen anderen Vorhaben. Ich habe vor, im Zentralen Staatsarchiv der Republik einige Recherchen vorzunehmen, das Deutsche Haus zu besuchen und dort einige historische Sachverhalte mit dem interessierten Publikum besprechen. Es war mir eine große Freude, hier auftreten zu dürfen.
Der Anlass ergab sich aus dem Umstand, dass das akademische Institut für Geschichte und Ethnologie, die in Kasachstan führende Institution auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaft, ihr 80. Gründungstag feierte. Mich verbindet viel mit dieser Forschungseinrichtung, weil ich hier Doktorand war und 1992 über die Geschichte der deutschen Siedler in Kasachstan vor 1917 promovierte. Ich danke den kasachischen Kollegen, dass sie mich zu der Jubiläumskonferenz anlässlich der Gründung des Instituts eingeladen haben. Gleichzeitig verbinde ich meine Reise mit einigen anderen Vorhaben. Ich habe vor, im Zentralen Staatsarchiv der Republik einige Recherchen vorzunehmen, das Deutsche Haus zu besuchen und dort einige historische Sachverhalte mit dem interessierten Publikum besprechen. Es war mir eine große Freude, hier auftreten zu dürfen.
Sie haben es schon ein wenig angesprochen – welche Themen oder Schwerpunkte möchten Sie bei Ihren Vorträgen und Begegnungen hier besonders hervorheben?
2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal – in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion spricht man ja vom „80. Jahrestag des Sieges über das faschistische Deutschland“.
Ich persönlich sehe diesen Jahrestag allerdings differenziert. Das Kriegsende war für Deutschland eine katastrophale Niederlage – und doch war es gut, dass diese Niederlage eintrat. Sie hat die deutsche Gesellschaft nachhaltig geprägt und hatte auch großen Einfluss auf die Lage der deutschen Minderheiten weltweit, besonders in der UdSSR.
In meinen Vorträgen möchte ich die Ergebnisse meiner Forschungen vorstellen, die sich mit den Folgen des Krieges für die Russlanddeutschen befassen. Ich habe dazu eine wissenschaftliche Arbeit vorbereitet und möchte meine Sichtweise darlegen sowie die Diskussion mit den Nachgeborenen anregen und fortsetzen.
Sie haben dazu auch einen Vortrag gehalten. Wie gestaltet sich die rechtliche Situation der Deutschen in der UdSSR nach 1945, und welche Unterschiede gab es zwischen Gesetzgebung und Praxis?
 Ich habe versucht, das Thema auf Russisch darzustellen, obwohl mir wissenschaftliches Schreiben auf Russisch inzwischen schwerer fällt als auf Deutsch. Es gibt bereits Forschungen über die Lage der Minderheiten in der Nachkriegszeit, aber der Schwerpunkt des Vortrages liegt auf der Zeit des Spätstalinismus.
Ich habe versucht, das Thema auf Russisch darzustellen, obwohl mir wissenschaftliches Schreiben auf Russisch inzwischen schwerer fällt als auf Deutsch. Es gibt bereits Forschungen über die Lage der Minderheiten in der Nachkriegszeit, aber der Schwerpunkt des Vortrages liegt auf der Zeit des Spätstalinismus.
Aus vielen zeitgenössischen Dokumenten ergibt sich deutlich, dass die Betroffenen das Kriegsende sehnsüchtig erwartet hatten. Die meisten Deutschen in der Sowjetunion verurteilten den Überfall auf die UdSSR und wollten ehrlich ihrem Land dienen. Selbst in den Arbeitslagern hofften viele, nach Kriegsende ihre Rechte zurückzuerhalten. Sie glaubten, die Einschränkungen während des Krieges seien eine vorübergehende Maßnahme, die danach aufgehoben würde.
Doch die stalinistische Führung dachte nicht im Geringsten daran. Im Gegenteil: Sie zementierte die Ergebnisse der Kriegszeit – nicht nur für die “Sowjetbürger deutscher Nationalität“, sondern auch für andere deportierte Völker. Für die Deutschen war die Lage jedoch besonders schwer, weil man sie mit dem verhassten Feind identifizierte. Sie waren rechtlos und wurden weiterhin als Landesverräter betrachtet, sowohl von den Behörden als auch von den Nachbarn anderer Nationalität. Das machte ihr Leben doppelt so schwer.
Viele Deutsche versuchten, sich trotz der schwierigen Umstände in die sowjetische Gesellschaft zu integrieren. Wie sah ihr Selbstverständnis nach dem Krieg aus?
Es ist schon bemerkenswert, dass viele – nicht nur Intellektuelle, sondern auch die breite Schicht der Betroffenen, die die sowjetische Schule durchlaufen hatten –sich tatsächlich als Sowjetmenschen fühlten und vor allem gleichberechtigte Bürger ihres Landes sein wollten. Nach Stalins Tod erkannte die Regierung, dass die extreme Unterdrückung kontraproduktiv war. Man versuchte, das Leben zu normalisieren und die sogenannte sozialistische Gesetzlichkeit wiederherzustellen. Davon profitierten auch die Deutschen, deren Alltag sich langsam stabilisierte.
Welche Rolle spielte in dieser Zeit die Religion?
Eine sehr große. Das zeigen auch interne Berichte der sowjetischen Behörden. Bei den Deutschen, wie auch bei anderen innerhalb der Sowjetunion deportierten Völkern, war die Religiosität deutlich stärker ausgeprägt als in der übrigen Bevölkerung. Es gab Eltern, die ihre Kinder ungern in die Schule schickten, weil sie der Überzeugung waren, nur der Glaube kann ihnen Halt im Leben geben. Für viele war Religion die einzige geistige Zuflucht in einer Situation, in der sie sich unterdrückt und als „politisch tot“ empfanden.
Wie veränderte sich die Lage nach dem Krieg?
Allmählich verbesserte sich die wirtschaftliche Situation, die Zwangsarbeitslager wurden aufgelöst, Familien durften wieder zusammenkommen. Auch wenn die Deutschen weiterhin als Sondersiedler galten, kehrte langsam ein normales Familienleben zurück. Mit der Zeit, besonders ab 1955, wurden die meisten Einschränkungen aufgehoben.
Trotzdem hielten sich lange Mythen über die Russlanddeutschen. Woher kam das?
Die Deportation war offiziell mit angeblicher „verräterischer Tätigkeit“ begründet worden. Diese Lüge wurde später zwar abgemildert, aber nie klar widerlegt. Da die Autonomie der Wolgadeutschen nicht wiederhergestellt wurde, blieben die alten Gerüchte bestehen. Es gab auch keine wissenschaftliche Aufarbeitung. Zwar wurde 1946 in einem Strafprozess gegen die ehemalige Partei- und Staatsführung der Wolgadeutschen Republik festgestellt, dass es kein Komplott und keine Verbindung mit Nazideutschland gegeben hatte, doch das Ergebnis wurde nie veröffentlicht. So lebten die Mythen weiter. Bis heute fehlt eine konsequente öffentliche Aufarbeitung und auch institutionelle Vertretung der Deutschen in Russland.
In Ihrer Arbeit zeigen Sie viele historische Dokumente. Welche Quellen sind für Sie besonders wichtig?
Die Grundlage jeder historischen Forschung sind die zeitgenössischen Quellen. Ich arbeite mit staatlichen Akten, privaten Briefen, Tagebüchern und auch mit mündlichen Überlieferungen. Besonders wertvoll sind persönliche Zeugnisse. Sie zeigen, wie die Menschen zu dieser Zeit tatsächlich dachten und fühlten. Ich habe hunderte Briefe aus der Kriegszeit gesammelt, die auf Deutsch oder Russisch verfasst sind. Schon aus der Sprache lässt sich viel ablesen, etwa über Bildung oder Identität. Auch die Digitalisierung hilft sehr, weil man nun Originale sehen kann – mit Schreibfehlern, mit Zittern der Hand, das vermittelt eine andere Nähe.
Gab es ein Dokument, das Sie besonders bewegt hat?
Ja, es geht um eine Regierungsverordnung vom 18. November 1942, unterschrieben vom zweiten Mann im Staate, Wjatscheslaw Molotow. Darin wurde angeordnet, dass Kinder deutscher Eltern, die beide ins Arbeitslager zwangsmobilisiert worden waren, auf benachbarte kasachische, russische oder ukrainische Familien verteilt werden sollten. Kinder unter acht Jahren kamen ins Waisenhaus, ältere in Pflegefamilien. Das war einzigartig – kein anderes Volk in der UdSSR wurde so behandelt. Für mich ist das eines der deutlichsten Zeichen für die Tragik dieser Zeit. Viele dieser Kinder wuchsen in fremden Familien auf, verloren ihre Sprache und Herkunft, wurden von den leiblichen Eltern nie wiedergefunden. Das ist, nach jedem juristischen Maßstab, eine genozidale Handlung gemäß Artikel II (e) der Genozid-Konvention.
Wenn Sie auf die Gegenwart blicken – was wünschen Sie sich für die Erinnerungskultur, sowohl in Kasachstan als auch in Deutschland?
Ich wünsche mir, dass die Erinnerung an diese unselige Zeit fest im familiären Gedächtnis verankert wird. Jeder Mensch sollte wissen, was die eigene Familie, was die Vorfahren erlebt und durchgemacht haben. Das ist wichtig, um die Eltern oder Großeltern zu verstehen – und auch sich selbst. Nur wer weiß, welche Herausforderungen seine Vorfahren bestanden haben, kann die Gegenwart mit mehr Gelassenheit sehen. Natürlich haben wir auch heute Probleme, aber sie sind nicht mit dem Leid jener Generationen zu vergleichen.
Erinnerung ist aber nicht nur privat, sie ist auch Teil eines größeren Ganzen. Jede Nation hat ihre eigene Erinnerung, aber keine dieser Erinnerungen ist wichtiger oder richtiger als die andere. Sie ergänzen sich, sie sind Mosaiksteine eines gemeinsamen historischen Gedächtnisses. Ich wünsche mir, dass diese Vielfalt respektiert wird. Toleranz beginnt damit, dass wir auch die Erinnerungen anderer ernst nehmen.
Die Geschichte der Russlanddeutschen ist ein legitimer Teil der europäischen Erinnerungskultur. Wer seine Vergangenheit verdrängt, verliert auch die Zukunft. Erinnerung heißt nicht, in der Vergangenheit zu verharren, sondern aus ihr Kraft zu schöpfen. Wir erinnern uns – und gehen weiter.
Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Annabel Rosin.