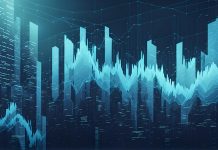Kasachstan strebt eine führende Rolle in der „grünen“ Energiewirtschaft an. Das Land verfügt über 154 Anlagen für erneuerbare Energien (EE) mit einer Gesamtleistung von mehr als 3 GW. Im Jahr 2024 erreichte der Anteil der EE an der gesamten Stromerzeugung 6,43%, was eine Verdoppelung gegenüber 2020 darstellt.
Dieser Fortschritt ist das Ergebnis einer entschlossenen staatlichen Politik, die sich ehrgeizige Ziele gesetzt hat: Bis 2030 soll der Anteil der EE an der gesamten Stromerzeugung auf 30% und bis 2050 auf 50% steigen. Doch während das Landes mit hohem Tempo voranschreitet, wird ein wichtiges Problem übersehen: der gesamte Lebenszyklus der jeweils verwendeten Technologien und die Entsorgung der Abfälle am Ende des Zyklus.
Hinter den Slogans zur Umweltfreundlichkeit der erneuerbaren Energien verbergen sich die Schwierigkeiten bei der Entsorgung jener Komponenten, die für die Erzeugung der EE genutzt werden. Die Lebensdauer der meisten Solarmodule und Windkraftanlagen beträgt 10 bis 30 Jahre, aber viele fallen früher aus. Laut IRENA, der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien, werden mehr als 90% der Module, deren Entsorgung bis 2030 erwartet wird, vorzeitig außer Betrieb genommen. Da Kasachstan bereits 2014 mit der Einführung von EE begonnen hat, sammeln sich im Land schon jetzt erste Abfallmengen an, die eine spezielle Behandlung und Entsorgung erfordern.
Alarmierende Prognosen
Das Problem ist, dass zahlreiche EE-Komponenten in Kasachstan und in ganz Zentralasien nicht als Elektronikabfälle eingestuft werden, während sie in der EU unter diese Kategorie fallen. Die Prognosen sind alarmierend: Bis 2049 werden die Abfälle aus kasachischen Solaranlagen 8.700 Tonnen überschreiten, und bis 2056 müssen etwa 33.000 Tonnen aus stillgelegten Windkraftanlagen entsorgt werden.
Die Komponenten von EE sind komplex und schwer zu recyceln. Solarmodule bestehen aus Glas, Aluminium, Silizium, Polymeren sowie Spuren von Blei und Zinn. Eine unsachgemäße Entsorgung kann das Trinkwasser verunreinigen und ganze Ökosysteme schädigen. Auch die Produktion selbst ist nicht umweltfreundlich, da sie unter anderem den Einsatz giftiger Substanzen erfordert.
Ähnlich verhält es sich mit den Rotorblättern von Windkraftanlagen, die aus schwer recycelbaren Verbundwerkstoffen bestehen. Die Gewinnung reiner Abfallstoffe aus ihnen ist ein aufwendiges und kostspieliges Verfahren. Daher landet der Großteil der Abfälle auf Deponien, was gegebenenfalls wertvolle landwirtschaftliche Flächen beansprucht.
Die umweltfreundlicheren Alternativen
Trotz dieser Herausforderungen sind EE nach wie vor weitaus umweltfreundlicher als traditionelle Energiequellen. Der Windenergie-Experte Emin Askerov stellt fest, dass die CO₂-Emissionen bei der Entsorgung von Windkraftanlagen um das 3.000-fache geringer sind als bei Kohlekraftwerken:
Vergleichen wir die CO₂-Emissionen pro 1 MW/h Energieerzeugung durch Sonnenkollektoren, Windkraftanlagen und Kohlekraftwerke unter Berücksichtigung der Abfallentsorgung. Ein Sonnenkollektor wiegt etwa 20 Kilogramm (einschließlich Montagesystem und Befestigungsmaterial) und erzeugt bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 25 Jahren rund 10 MW/h. Das sind 20 kg Abfall oder etwa 2 kg Abfall pro 1 MW/h über die gesamte Lebensdauer des Moduls. Bei derselben Leistung von 1 MW/h entstehen in einem Kohlekraftwerk 80–100 kg feste Abfälle und 900 kg CO₂. In Gaskraftwerken gibt es zwar keine Verbrennungsabfälle, aber immerhin 400 kg CO₂ pro MW/h. Und dabei berücksichtigen wir noch nicht die lokale Luftverschmutzung durch Kohlekraftwerke, die langfristig zu beobachtenden Atemwegserkrankungen und damit verbundene Todesfälle. Und wie viel CO₂ produziert ein Solarmodul? – Null.
In Kasachstan, wo 77% des Stroms aus Kohle erzeugt werden, entstehen jährlich rund 120 Millionen Tonnen CO₂ und mindestens 7 Millionen Tonnen giftige Abfälle. Ein vollständiger Übergang zu Solarenergie würde die jährliche Abfallmenge um das 31-fache reduzieren, und 80% dieser Abfälle aus der Solarenergie-Erzeugung könnten recycelt werden.
Experten schätzen, dass der Wert der recycelbaren Rohstoffe aus Solarmodulen bis 2050 auf über 15 Milliarden US-Dollar steigen könnte, was ein erhebliches wirtschaftliches Potenzial darstellt.
Das Prinzip der EHV
Führende EE-Nutzer wie die EU, die USA und China setzen bereits auf das Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung (EHV). Dieses Konzept verpflichtet die Hersteller, für den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte, einschließlich deren fachgerechter Entsorgung, verantwortlich zu sein. Die EU beispielsweise hat Solarmodule in ihre Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte aufgenommen und eine Mindestquote von 80% für Wiederverwendung und Recycling festgelegt.
In der kasachischen Gesetzgebung gibt es keine gesonderten Vorschriften für die Entsorgung von EE-Abfällen und das EHV-Prinzip wird noch nicht angewendet. Eine Umfrage des Verbands „Qazaq Green“ ergab, dass die Entsorgungskosten von den Betreibern oft nicht in die Projektbudgets einkalkuliert worden sind.
Um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten, sollte Kasachstan jetzt handeln. Erstens sollten die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche die EE-Abfälle klassifizieren und das Prinzip der EHV gesetzlich verankern. Zweitens sollte die EE-Infrastruktur weiter aufgebaut werden und Investitionen in Verwertungsanlagen für EE-Komponenten durch Steuererleichterungen und vergünstigte Kredite gefördert werden.
Diese Maßnahmen werden nicht nur die nachhaltige Entwicklung der Energiebranche sicherstellen, sondern auch den Übergang Kasachstans zu einer Kreislaufwirtschaft vorantreiben.