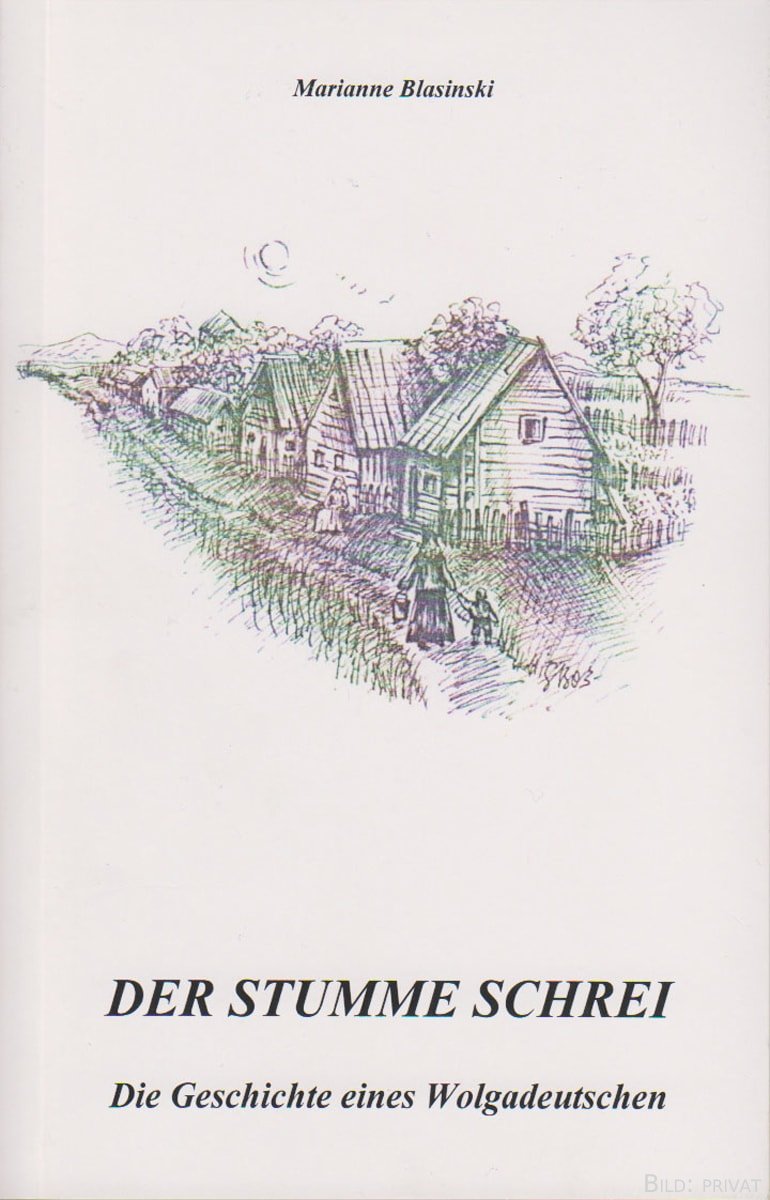In dem Buch „Der stumme Schrei“ schildert Marianne Blasinski die Lebensgeschichte des Wolgadeutschen Johannes Hasenkampf. Bis zur Deportation seiner Familie nach Sibirien hatte er zwei Jahre die deutsche Grundschule in seinem Dorf besucht. Nachdem sein Vater und großer Bruder zur Trudarmee gezwungen wurden, war er mit zehn Jahren der Ernährer seiner Mutter und seiner fünf Schwestern. Ein weiterer Schulbesuch fand nicht statt. Seine Geschichte hat seine Landsmännin Irina Maier nach seinen Erzählungen notiert. Sie wurde Marianne Blasinski anvertraut. Die Schriftstellerin bemühte sich, ihre Ursprünglichkeit zu bewahren. Ein Auszug aus dem Buch.
/Bild: privat. ‚Die Lebensgeschichte des Wolgadeutschen Johannes Hasenkampf – erzählt von Marianne Blasinski.’/
„Im Frühjahr 1942 begann ich als Hirtenknabe auf den Wiesen beim Schafhirten Tschantschikow Semjon zu arbeiten, einem Russen, der kein Deutsch und ich kein Russisch verstand. Im Laufe der Zeit verständigten wir uns mühsam. Er war gutherzig und teilte sein Brot und seine Milch mit mir. Ich versteckte aber dieses Brot unter meinem Hemd und brachte es abends für die Kleinen mit nach Hause. Sie standen schon immer hungrig am Fenster und warteten auf mich. Manchmal nahm mich der Schafhirt auch mit in sein Haus und gab mir etwas Warmes zu essen. Das gefiel seiner Frau, einer unfreundlichen Person, überhaupt nicht. Sie brummte jedes Mal, wenn sie mich in ihrem Haus sah. Das ängstigte mich.
Aber der Hirt klopfte mir leise auf die Schulter, und wenn ich ihn richtig verstand, so meinte er wohl: „Komm Junge, sie brummt zwar, aber sie wird uns schon was auf den Tisch stellen!” Tatsächlich brachte sie uns Brot, Milch und Kartoffeln – und verschwand. Nun konnte ich in Ruhe essen und dachte doch immer an meine hungrigen Schwestern.
In der Kriegszeit gab es viele Wölfe in dieser Gegend. Der Hirte bekam eine alte Jagdflinte sowie Pulver und Schrot.
Eines Tages kamen die Wölfe sehr nahe an die Schafe heran.
„Treibe die Tiere alle in einen Sommerschuppen”, sagte der Hirte zu mir, „da sind sie in Sicherheit. Und dann wollen wir mal den Bestien Furcht unter den Schwanz jagen, damit sie nicht frech werden. Ich zeige dir, wie man schießt.” Er knallte einige Male in die Luft. Es schien uns, als zögen die Wölfe weiter. Nun wollte ich die Schafe aus dem Schuppen wieder herauslassen. Doch wie erschrak ich, als ich auf dem Stroh fünf gerissene Tiere liegen sah. Mit lautem Schrei lief ich zum Hirten, der sofort zu verstehen schien, was geschehen war. „Während wir geschossen haben, hat sich wohl einer der Wölfe durch das Dach in den Schuppen geschlichen und uns das angetan”, seufzte er traurig. Die toten Schafe wurden zur Feldküche gebracht. Die russischen Arbeiter, die man ihres Alters wegen nicht mehr zum Militär eingezogen hatte, waren froh, mal ein Stückchen Fleisch in der Suppe zu finden.
Besonders schlimm für uns war es in der Nacht oder wenn wir die Schafe von einem Weideplatz zum anderen jagen mussten. Da konnten wir uns der Wölfe nicht erwehren. Sie kamen hinterher und rissen die Tiere aus der Herde heraus. Man sagt, der Wolf hätte Angst vor dem Feuer. Ja, wenn er satt ist. Ist er hungrig, so greift er an und ist durch nichts zu verjagen. So vergingen die Monate – vom Frühling bis in den späten Herbst hinein.
Zu dieser Zeit mussten wir weg von unserer geliebten NaschaBabuschka. Man brachte uns in einem etwas größeren Haus unter, in dem wir aber nur ein winziges Zimmerchen bewohnen durften: Mutter mit ihren sechs Kindern, das kleinste, unsere Hermine, konnte gerade mal laufen.
Als es Winter wurde, musste ich mit anderen Jungen das Stroh vom Feld ins Dorf bringen. Man spannte vor jeden Schlitten einen Ochs. Wir luden die Schlitten voll und los ging es. Wir froren jämmerlich, denn es war sehr kalt und warme Kleidung gab es für uns noch immer nicht. Solange wir das Stroh aufluden, uns kräftig bewegten, war die Kälte zu ertragen. Doch die Ochsen gingen langsam und wir mussten hinterher trollen, so dass uns ganz kalt wurde.
Aber wir wussten uns zu helfen. Wir zupften aus dem letzten Schlitten Stroh heraus, zündeten es an und wärmten uns ein bisschen. Dann liefen wir schnell den Ochsen nach. Und so ging es weiter, bis wir wieder durchfroren waren. Als wir das Dorf erreichten, war der letzte Schlitten total leergezupft.
Ab Frühjahr 1943 musste ich das Rindvieh der einheimischen Bauern hüten. Schon früh um fünf wurden die Tiere von den Höfen auf die Weide getrieben. Ich bekam keinen Lohn. Jeder Wirtshof, immer der Reihe nach, musste mich morgens füttern und für den ganzen Tag eine Flasche Milch, ein Stück Brot oder Kartoffeln mitgeben. Ich brachte es fast immer für meine Mutter und meine Geschwister mit nach Hause. Sie freuten sich schon sehr darauf.
Zur Osterzeit musste ich wehmütig an das Osterfest zu Hause an der Wolga denken. Damals hatte die Mutter für uns Kinder Süßigkeiten gebacken und Eier bemalt, die sie auf dem Hof versteckte. Wir suchten sie voller Eifer. Jetzt gab es keine Süßigkeiten und keine bemalten Eier mehr. Doch Not macht erfinderisch. Um meine Geschwister zu erfreuen kletterte ich auf einen hohen Baum in der Nähe des Dorfes, auf dem sich Raben Nester gebaut hatten. Und da gerade Paarungszeit war, müsse es wohl auch Eier geben, so dachte ich. Ich hatte Glück. Sorgfältig nahm ich zwei kleine Eier heraus und tat sie in einen Beutel, den ich mitgebracht hatte. Aber da kam die Rabenmutter zurück und machte höllischen Spektakel, so dass ich es mit der Angst zu tun bekam, denn ein zorniger Rabe kann sehr kräftig mit seinem Schnabel hacken. Ich duckte meinen Kopf und kletterte eilends den Baum wieder hinab. Die Eier waren gerettet.
Doch waren zwei Eier zu wenig für unsere Kinderschar. Und so beschloss ich, noch andere Nester zu berauben. Mutter schimpfte ein bisschen über meine Tat. Aber sie kochte die Eier und bemalte sie mit Tintenbleistift. Die Kleinen freuten sich riesig, denn außerdem gab es nichts.
Als man uns aus unserer Heimat vertrieb, gab man uns das Versprechen, dass jeder, der sein Vieh dem Staat überließ, auch in seiner neuen Heimat Tiere bekäme. Doch geschah lange Zeit nichts.
Aber dann brachte Mutter eines Tages eine Kuh mit nach Hause, ein elendes Gestell aus Haut und Knochen, kaum dass sich das Vieh auf den Beinen hielt. Man konnte weinen, so Leid tat einem diese Kuh. Der Winter war gottlob vorüber. Wir Kinder hatten ihn aller Kälte zum Trotz gut überstanden. Nur unsere Mutter litt an Rheuma, wohl auch an Unterernährung und Erschöpfung. Auch lag ihr sicher das ungewisse Schicksal ihres Mannes und des ältesten Sohnes auf der Seele. In diesem Frühling musste ich das Rindvieh der Kolchose auf einer Weide weit weg vom Dorf hüten, ohne abends nach Hause gehen zu können. Es war schwer für mich, ganz allein zu sein. Nicht, dass ich große Angst gehabt hätte, nun ja, ein wenig schon. Nur war außer den Kühen niemand da, mit dem ich hätte reden können. Zu essen gab es auch nur sehr wenig. So sammelte ich Frühlingskräuter und aß sie. Vermutlich retteten sie mich vor vielen Krankheiten.
Ich baute mir eine Hütte aus Zweigen, um mich bei Tag vor der Sonne zu schützen. In der Nacht legte ich mich zwischen die Kälber, um nicht zu frieren. Wenn ich morgens erwachte, war ich nass und beschmiert. Schnell lief ich zum Bach, wusch mir den Schlaf aus den Augen und nahm mir Wasser zum Trinken. Hatte ich noch ein Stück Brot, so konnte ich frühstücken. Wenn die Melkerinnen zum Melken kamen, fiel auch manchmal ein Becher kuhwarmer Milch für mich ab.
Waren die Felder für eine Frühlingssaat nicht weit von der Weide entfernt, so lief ich schnell zum Bauern und bat um eine Handvoll Saatkorn. Manchmal gaben sie mir heimlich ein bisschen, denn es war auch für die russischen Bauern streng verboten, Korn für eigene Zwecke zu entnehmen. Das war Diebstahl am Staat und wurde streng bestraft.
Schnell versteckte ich das Korn in der Hosentasche und lief zu den Kühen zurück. Dann machte ich mir Feuer und röstete das Korn in einer Blechdose. Es roch köstlich. Ich konnte es kaum erwarten, bis ich es ein bisschen zermahlen essen konnte.
Ende Juni kam ein Mädchen zu mir auf die Weide gelaufen und sagte: „Der Kolchosvorsitzende ruft dich in sein Kontor. Du sollst so schnell wie möglich kommen. Ich bleibe solange beim Vieh.”
Ich bekam einen riesigen Schreck. Hatte vielleicht jemand gesehen, dass mir der Bauer Korn gegeben hatte? Komme ich jetzt ins Gefängnis? Oder habe ich was anderes falsch gemacht? So dachte ich den ganzen Weg über. Und dann noch die Angst, dass Mutter mich sehen und sich darüber Sorgen machen könnte, dass ich nicht auf der Weide war.
Mit klopfendem Herzen betrat ich das Gebäude des russischen Dorfrates, öffnete die Tür zum Schreiber und konnte kein Wort herausbringen. Der Schreiber, ein uralter Mann, der schon in der Zarenzeit dort gesessen hatte und den auch die Sowjets arbeiten ließen, weil niemand besser als er zu schreiben verstand. Der alte Mann sah mich lächelnd an und sprach zu mir.
Ich verstand kein anderes Wort als Wanja, womit er wohl mich meinte. Dann deutete er mit einer Handbewegung an, dass ich zum Vorsitzenden gehen solle. Meine Beine zitterten derart, dass ich sie kaum bewegen konnte. Ich hielt mich an der Wand fest, um nicht umzufallen. Aber der Vorsitzende sah mich nur an und sagte freundlich:
„Setz dich mal hin und beruhige dich. Wie geht es den Kühen draußen auf der Weide? Sind sie noch alle da? Hast du keine verloren?” Irgendwie verstand ich den Sinn seiner Worte.
Mir wurde schwindlig, sei es vor Hunger oder vor Angst. Nach einer Weile stotterte ich: „Ja, sie sind alle da.”
„Das ist sehr gut für dich, Wanja. Du heißt doch Wanja, oder nicht?”
Obwohl auf meiner Geburtsurkunde Johannes stand, wurde ich im Dorf auf Russisch Wanja oder Wanjuschka genannt. So nickte ich.
„Weißt du, Wanja, fast alle Frauen im Dorf beschweren sich über den Jungen, der jetzt die Kühe der Eigentümer hütet. Einige Kühe fehlen sogar. Alle Frauen wollen wieder dich als Hirten haben. Das ist doch eine Ehre, oder? Also ab morgen sammelst du wieder jede Kuh aus den Höfen. Die Kühe der Kolchose wird der alte Peter hüten. Ist das klar?” So halbwegs glaubte ich ihn verstanden zu haben.
Nach diesen Worten rannte ich wie der Wind zur Wiese hinaus und erzählte alles dem wartenden Mädchen. Und als es fort war, legte ich mich ruhig ins Gras, träumte und schaute lange, lange in den blauen Himmel hinein, bis meine Augen schmerzten. Ab morgen, dachte ich, ab morgen bekomme ich wieder etwas zu essen für mich und meine Familie.
Als die Sonne langsam unterging, kam der alte Peter. Er schaute sich die Herde an.
„Die Kühe sehen ganz gut aus. Jetzt kannst du nach Hause gehen und ich bleibe hier.”
Schnell suchte ich unsere Kuh, die ich mitnehmen musste, aus der Herde heraus. Jetzt sah sie nicht mehr so mager aus. Auch ihr Fell war glatter geworden. Als ich mit der Kuh nach Hause kam, bekam meine Mutter einen Riesenschreck. Sie hatte Angst, dass etwas passiert sein könnte. Doch nachdem ich ihr alles erzählt hatte, freute auch sie sich, weil wieder mehr zu essen ins Haus kommen würde. Bereits am nächsten Morgen ging ich von Hof zu Hof, jeden Tag, bis in den späten Herbst hinein.
Damals gab es ein Gesetz, nach dem alle Familien im Dorf, russische wie auch deutsche, Butter, Eier, Milch, Häute und Wolle dem Staat abgeben mussten. Wir hatten zwar eine Kuh, aber die Milch stand uns nie zur Verfügung. Außer der Magermilch und einem Becher Milch, der im Milcheimer übrig blieb. Davon kochte die Mutter uns Milchsuppe.
Alle Kolchosbauern bekamen keinen Lohn wie die Arbeiter in den Werken, sondern Arbeitseinheiten, für jeden Arbeitstag eine. Nach der Ernteeinbringung wurde jeder nach der Zahl der Arbeitseinheiten entlohnt. Aber einige Jahre lang bekamen sie überhaupt nichts. Es hieß, das schuldeten sie dem Kolchos, weil sie das ganze Jahr über zu essen bekommen hatten.
Auch denen, denen man Arbeitseinheiten zugestanden hatte, ging es nicht sehr viel besser. Das zusammengefegte Korn, das nach dem Kornschwingen auf dem Boden liegen blieb, war voller Kornrade. Backte man daraus Brot, so konnte man es nicht essen. Es war bitter wie Chinin, wenn man es kaute. So wurde es nur mit dem Speichel befeuchtet und rasch heruntergeschluckt. Satt wurde man nicht davon.
An unserer Hungersnot waren wir ausgesiedelten Wolgadeutschen nicht ganz unschuldig. Man hatte alles Saatgut, das man von zu Hause mitgebracht hatte, für etwas Essbares eingetauscht, weil alle glaubten, dass wir bald wieder nach Hause zurückkehren würden. Und so konnten wir im Frühjahr weder Kartoffeln noch Rüben oder Kohl pflanzen. Land gab es genug und der Boden war sehr fruchtbar. Schon mit Kartoffeln und Kohl hätte man sich satt essen können. Man wartete eben ab, wartete vergeblich auf ein Wunder.“
Von Marianne Blasinski
—————————————————
Marianne Blasinski wurde 1928 als Tochter eines U-Bahnfahrers in Berlin geboren. Sie absolvierte acht Volksschuljahre und danach eine Lehre als Technische Zeichnerin. Nach Beendigung des Krieges arbeitete sie bis zur Heirat in verschiedenen Jobs, war nach der Scheidung alleinerziehende Mutter eines Sohnes und bis zur Pensionierung erneut im gelernten Beruf tätig.
Marianne Blasinski begann mit zwanzig Jahren zu schreiben. In den siebziger Jahren wurden erstmals Erzählungen in mehreren Zeitschriften veröffentlicht. In den darauffolgenden dreißig Jahren erschienen in verschiedenen Verlagen vierzehn Bücher – Romane und Biografien. Die Autorin ist Mitglied des Freien Deutschen Autorenverbands (FDA) sowie Ehrenmitglied bei dem Verband der Gemeinschaften der Künstlerinnen und Kunstförderer e.V.