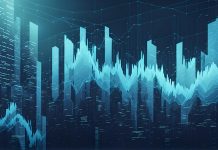Stiftung Verbundenheit fordert in der Bayreuther Erklärung eine neue Rolle für deutsche Minderheiten in der Außenpolitik.
Mit deutlichen Worten hat die Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland eine Kursänderung in der deutschen Außenpolitik gefordert. In der „Bayreuther Erklärung“ heißt es, Deutschland müsse mehr gelebte Verantwortung und Verbundenheit mit seinen Landsleuten in aller Welt zeigen.
Die Stiftung sieht in den rund 60 Millionen Menschen mit deutschen Wurzeln oder enger emotionaler Bindung zu Deutschland weit mehr als eine historische Erinnerungsgemeinschaft. Deutsche Minderheiten seien Brückenbauer zwischen Deutschland und ihren Heimatländern, Vermittler eines modernen, pluralistischen Deutschlandbildes und Sympathieträger für demokratische Werte. Sie könnten neue Zugänge zu Gesellschaften eröffnen, die klassischen Mittlerorganisationen oder staatlicher Diplomatie oft verschlossen blieben.
Ein Schlüsselbegriff des Papiers ist die Bürgerdiplomatie. Gemeint ist damit ein Ansatz, der nicht auf staatliche Institutionen setzt, sondern auf Begegnungen, zivilgesellschaftliches Engagement und persönliche Biografien. Solche Kontakte wirkten über Generationen hinweg, bauten Vertrauen auf und schafften langfristige Bindungen – unabhängig von politischen Systemen und Grenzen. Von Kulturvereinen und Bildungsinitiativen über Unternehmerinnen und Wissenschaftler bis hin zu Kulturschaffenden und Aktivisten: Sie alle könnten dazu beitragen, ein glaubwürdiges, modernes Bild Deutschlands zu vermitteln.
Förderung soll modernisiert werden
Darüber hinaus fordert die Stiftung eine Modernisierung der Förderpolitik. Bislang konzentrierte sich die Unterstützung vor allem auf deutsche Minderheiten in Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien. Künftig müssten verstärkt auch Gemeinschaften in Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und Ozeanien einbezogen werden. Besonders betont die Erklärung die rund 200.000 deutschsprachigen Israelis, die bislang von Förderprogrammen ausgeschlossen sind. Förderpolitik dürfe deutsche Minderheiten und deutschsprachige Gemeinschaften nicht länger als passive Empfänger betrachten, sondern müsse sie als aktive Partner in Sprache, Kultur und Wertevermittlung ernst nehmen.
Auch wirtschaftlich könnten deutsche Minderheiten wichtige Chancen eröffnen. Angesichts des zunehmenden Drucks auf das deutsche Exportmodell seien sie glaubwürdige Türöffner für neue Märkte und Partner in Innovations- und Fachkräfteallianzen. Ihre lokale Verwurzelung und kulturelle Kompetenz ermöglichten Zugänge, die klassische außenwirtschaftliche Instrumente oft nicht erreichten.
Die Erklärung legt zudem besonderen Wert auf die Stärkung demokratischer Teilhabe. Viele Angehörige deutscher Minderheiten besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft, ihre politische Mitbestimmung müsse aber durch vereinfachte Wahlmöglichkeiten bei Bundestags- und Europawahlen im Ausland gesichert werden. Sichtbarkeit und Teilhabe seien ein zentraler Bestandteil demokratischer Rechte. Gleichzeitig fordert die Stiftung, dass Deutschland sich international stärker für den Schutz ethnischer und sprachlicher Minderheiten einsetzt. Die mangelnde Anerkennung der deutschsprachigen Minderheit in Slowenien sei ein Beispiel dafür, wie fragil das europäische Schutzsystem sei.
Im Fazit der Erklärung wird betont, dass die Einbindung deutscher Minderheiten kein nostalgisches Projekt sei, sondern ein zukunftsweisender Beitrag zu einer nachhaltigen Positionierung Deutschlands in der Welt. Deutschlands internationale Rolle hänge nicht allein von wirtschaftlicher Stärke oder außenpolitischen Strategien ab, sondern auch von glaubwürdigen, langfristigen Beziehungen zu Zivilgesellschaften weltweit. Mit der Bayreuther Erklärung fordert die Stiftung Verbundenheit daher, deutsche Minderheiten und deutschsprachige Gemeinschaften als unverzichtbare Partner anzuerkennen – politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich.