Behördlich sind sie den Bundesdeutschen zwar gleichgestellt. Weil ihre Herkunft und Geschichte jedoch wenig bekannt sind, fühlen sich nicht alle Russlanddeutschen in Deutschland akzeptiert. Eine neue Forschungsarbeit zeigt, welche Erfahrungen der Russlanddeutschen ihre Integration beeinflussen und was Gesellschaft und Politik daraus lernen können.
„Wenn du zum Beispiel zu einem Vorstellungsgespräch kamst, war die erste Frage: ‚Schulz? Sind sie Deutsche?‘ Ich hatte mich so geschämt und mir immer gewünscht, dass mein Name irgendwie russisch klingt“, sagt Galina Schulz. Die heute 62-Jährige wuchs in Kasachstan auf und kam Anfang der 1990er als Aussiedlerin nach Deutschland. Wie alle Deutschstämmigen in der ehemaligen Sowjetunion stand auch ihre Familie seit dem Zweiten Weltkrieg unter dem Verdacht, mit Hitlerdeutschland kollaboriert zu haben. Sie wuchs mit dem Vorwurf auf, an den Opfern des so genannten Großen Vaterländischen Krieges schuld gewesen zu sein. „Deutsch“ wurde gleichgesetzt mit „Faschist“ und führte in vielen Lebensbereichen zu Benachteiligungen gegenüber der übrigen Bevölkerung. Beispielsweise war Deutschen der Zugang zu bestimmten Studiengängen oder zu Posten mit hohem Prestige versperrt.
Lesen Sie auch: „Als wir gingen, nahmen wir alles mit“
Während in der Sowjetunion ein Eintrag im Pass die Nationalität belegte, mussten ausreisewillige Russlanddeutsche sie den deutschen Behörden aufwendig beweisen. „Die Überprüfung hat Monate gedauert und dann immer wieder wie ein Vorwurf: ‚Sind Sie tatsächlich deutsch?‘“, sagt die Russlanddeutsche Lilly Wagner. Auch nach der Einreise in Deutschland stellten Erfahrungen im Alltag oder mit Behörden ihr Selbstbild in Frage: „Ich war Ärztin, hatte studiert und bekam hier nichts anerkannt außer dem nackten Studium, keinen Facharzt, rein gar nichts“, sagt Wagner.
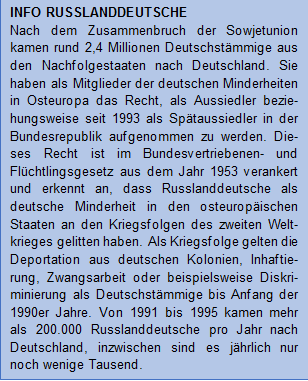
Als Beruf trug ihre Sachbearbeiterin im Aufnahmelager „Erzieherin“ ein. „Die junge Frau meinte zu mir: ‚Ärztin, das kann nicht sein!‘ ‚Ja was kann nicht sein?‘, fragte ich sie dann. ‚Dass ich Medizin studiert habe? Meinen Sie, von dort kommen nur Idioten oder wie?’”, sagt Wagner. Dass ihre berufliche Qualifikation nicht anerkannt wurde, empfand sie als persönliche Degradierung und massive Entwertung. Lilly Wagner glaubte, in Deutschland würde ihre Herkunft nicht länger von Nachteil sein, doch Behörden fühlte sie sich manchmal genauso ausgeliefert wie in Kasachstan.
Wie wirken sich solche Erfahrungen auf die Integration von Menschen aus, will Marit Cremer wissen. Die promovierte Soziologin interviewte im Rahmen einer Forschungsarbeit der Menschenrechtsorganisation MEMORIAL Deutschland Russlanddeutsche, die heute in Deutschland leben. Sie befragte sie unter anderem zu Identität und Heimat, den Gründen für ihre Ausreise in die Bundesrepublik sowie zu ihrer politischen Orientierung. „Weil sich das Gefühl, gegenüber der Mehrheitsgesellschaft ungenügend zu sein, für viele Russlanddeutsche in Deutschland wiederholte, erzeugte es häufig Frustration und Widerspruch, aber auch Rückzug, Enttäuschung und Verunsicherung“, so Cremer.
Lesen Sie auch: Nur keine falsche Scham
In Deutschland angekommen, machten viele Russlanddeutsche die Erfahrung, von der Bevölkerung als Russinnen und Russen wahrgenommen zu werden. „Hinzu kam, dass ihnen die deutsche Herkunft oft nicht geglaubt wurde“, sagt die Forscherin. Hier fehle es an Wissen um die Geschichte der Deutschen, die sich seit dem 18. Jahrhundert im russischen Reich angesiedelt hatten, später von der kommunistischen Partei enteignet und nach Sibirien oder Zentralasien deportiert wurden. „Diese Wissenslücke lässt beiRusslanddeutschen einen Rechtfertigungsdruck entstehen, die Einwanderung nach Deutschland erklären zu müssen“, erklärt sie.

So fällt die Bilanz nach über 20 Jahren in Deutschland für mehrere der Interviewten gemischt aus, stellt Marit Cremer fest. Wie Galina Schulz macht ein Großteil der repatriierten Deutschen die Erfahrung, nicht dazuzugehören: „In Kasachstan waren wir zu viel deutsch, hier zu wenig. Ich wollte unbedingt, dass Deutschland meine Heimat ist. Denn ich gehöre hierher und in Kasachstan war ich immer ein bisschen fremd“, sagt sie. Damit ihre Kinder in Deutschland akzeptiert werden, erziehen sie viele wie Schulz ausschließlich mit deutscher Kultur und Sprache. Auf diese Weise werde jedoch die besondere russlanddeutsche Identität aufgegeben, so Wissenschaftlerin Cremer. Vor allem dann, wenn die – wenn auch oftmals schmerzhafte – Geschichte der eigenen Familie nicht weitergegeben werde.
Neben dieser „Überassimilation“ bei der Erziehung der Kinder zeigt ihre Studie auch weitere Strategien der Russlanddeutschen bei der Bewältigung der Herausforderungen in Deutschland: „Manche ziehen sich komplett ins Private zurück, andere knüpfen an sowjetische identitätsstiftende Praktiken der Vergangenheit an und suchen ihren Platz in einem weitgehend russischsprachigen Netzwerk“, sagt Cremer. Das wiederum festige das Bild, dass manche Bundesdeutsche von Russlanddeutschen als „Russen“ haben und grenze sie als Gruppe noch mehr aus.
Lesen Sie auch: „Wir sind Russlanddeutsche und wir sind Europäer“
„Ob sich ein Einwanderer – egal welcher Herkunft – gut integrieren kann, hängt nicht allein von seinen Bemühungen ab“, fasst Cremer zusammen. Nach Meinung der Wissenschaftlerin ist die Gesellschaft, die Einwanderer aufnimmt, genauso gefordert. Im Fall der Russlanddeutschen sei es wichtig, über deren Herkunft, die gemeinsamen deutschen Wurzeln und deren Schicksal infolge des Zweiten Weltkrieges aufzuklären. Das könnte laut Cremer im Geschichtsunterricht stattfinden. Bei den Bildungsabschlüssen wäre es aus ihrer Sicht sinnvoll, individuell zu prüfen, welche Qualifikation eine Person mitbringt, anstatt pauschal bestimmte ausländische Abschlüsse nicht anzuerkennen.
Cremer, die mit ihrer Forschungsarbeit Vorurteile gegenüber Russlanddeutschen abbauen und Lösungen für aktuelle Einwanderungsthemen anstoßen möchte, betont: Gerade für Einwanderer, die wie die Russlanddeutschen selbst oder deren Eltern traumatische Erfahrungen gemacht haben, sei die Frage nach Identität und dem Dazugehören oftmals sehr komplex und erfordere besondere Strategien. „Auch wenn die Russlanddeutschen im Großen und Ganzen als gut integriert gelten, sollte die Gesellschaft und Politik aus ihren Erfahrungen lernen, damit Integration in Deutschland künftig noch besser gelingt.“
Die aktuelle Forschungsarbeit der Menschenrechtsorganisation MEMORIAL Deutschland wurde im Rahmen des Projektes „Das Trauma der Deportation, Rückkehr und Nichtrückkehr – die zweite Generation der deportierten Russlanddeutschen“ veröffentlicht und steht hier als kostenloser Download zur Verfügung. Sie wurde vom Auswärtigen Amt Deutschland im Rahmen des Programms Östliche Partnerschaft und Russland gefördert.

Dr. Marit Cremer studierte Soziologie, Politikwissenschaften und Osteuropastudien in Rostock, St. Petersburg, Potsdam und Berlin. Seit 2015 leitet sie Projekte bei MEMORIAL Deutschland zur Erinnerungspolitik im postsowjetischen Raum und Deutschland. Ihre jüngsten Forschungen beschäftigten sich mit Bewältigungstrategien tschetschenischer Geflüchteter in Deutschland, Identitäten der zweiten Generation der deportierten Russlanddeutschen und den Erinnerungen von Kindern deutscher Gulaghäftlinge.



























